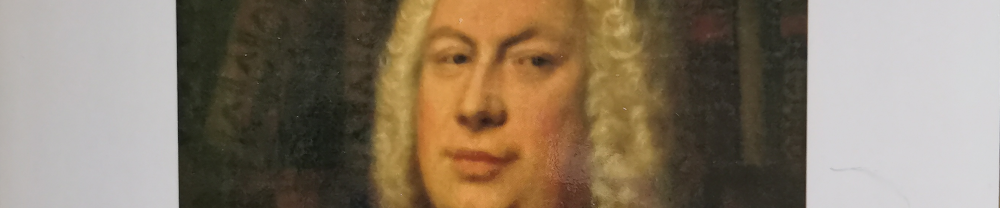Wer sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit deutscher Lyrik beschäftigte, kam um den Namen Hagedorn nicht herum. Das gilt sogar noch für die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts – erst als mit Hölty und Goethe zwei neue Sterne am lyrischen Himmel aufschienen, verblasste Hagedorns Ruhm allmächlich. Aber selbst noch in der so genannten Goethe-Zeit fällt sein Name regelmäßig. Deshalb gilt bis heute, dass, wer sich mit der deutschen Lyrik des 18. und frühen 19. Jahrhunderts beschäftigt, Hagedorns Namen überall antreffen wird. Gelesen wird er allerdings spätestens seit der Romantik kaum mehr. Schon zu meiner Zeit blieb er, selbst in germanistischen Oberseminaren, nur noch ein Name, dessen Lebensdaten man allenfalls zur Kenntnis nahm.
Die wiederum verorten Hagedorn eindeutig in der norddeutschen Literaten-Bubble seiner Zeit. Gebürtiger Hamburger (sein Vater stand dort eine Zeitlang in dänischen Diensten, geriet aber in wirtschaftliche Schwierigkeiten) studierte er die Rechte in Jena (damals eine günstige Universität, allerdings von schlechtem wissenschaftlichen Ruf). Er musste ohne Abschluss aus der Stadt fliehen, weil er dort zu viele Schulden gemacht hatte. Es folgte ein Abstecher nach London und die damals obligate Hofmeister-Zeit. Schließlich wurde er Sekretär einer englischen Handelsgesellschaft in Hamburg. Er machte offenbar keine nennenswerten Schulden mehr, führte allerdings trotz einer (allerdings kinderlos bleibenden) Ehe ein, wie man so schön sagt, ausschweifendes Leben: Er aß und trank übermäßig und war so etwas wie einer der ersten Kettenraucher. Das hinterließ früh Spuren an und in seinem Körper. Schon die Porträts des Mittdreißigers zeigen einen aufgedunsenen Mann. Gicht und Wassersucht plagten ihn schon früh; er starb entsprechend jung, mit 46 Jahren. Trotz der Tatsache, dass er selber kaum Geld hatte, verloren die deutschen Schriftsteller an ihm einen wichtigen Mäzen: Er benutzte seine Bekanntheit, und gab für junge Talente Empfehlungen an reiche Freunde, was auch wirksam war; oder dann initiierte er Geldsammlungen.
Sein Lebensstil spiegelt sich auch in seiner Dichtung (für die ihm seine Arbeit offenbar reichlich freie Zeit gewährte). „Wein, Weib und Gesang“ waren seine hauptsächlichen Themen. Anders gesagt: Er war der Anakreontiker seiner Zeit – vielleicht der deutschen Lyrik überhaupt. Und er war wirklich gut. Sich an Sappho und Anakreon orientierend, verwendete er eine flüssig perlende Sprache, die sich dem jeweilig verwendeten Versmaß anzupassen wusste, ohne dass man ihr irgendwelche Mühe anmerkt. Er verzichtete bewusst auf auf komplizierte Schemata, wie sie der Barock noch verwendet hatte. Daneben war Hagedorn aber nicht nur der verspielte Rokoko-Dichter. In frühaufklärerischer Manier orientierte er sich ebenso an Horaz und dessen Spruch Aut prodesse volunt aut delectare poetae. Was bei Horaz ein entweder – oder ist (übersetzt heißt sein Satz: „Die Dichter wollen entweder nützen oder unterhalten“), wurde von der Aufklärung verkürzt in ein Prodesse et delectare, Nützen und Unterhalten, woran sich dann auch Hagedorn hielt.
Seine Themen sind oft die klassisch anakreontischen. Allerdings ist er alles andere als ein schulmeisterlicher Langweiler oder Kopist. Natürlich weist seine Dichtung nicht den tiefen philosophischen bzw. metaphysischen Gehalt auf, den sie bei Schiller annehmen würde oder den Frühromantikern. Aber er kann, Vergil und Horaz folgend bzw. übersetzend, ebenso die ganze antike Götterwelt wieder zum Leben erwecken wie auf die Sitten im Römischen Reich schimpfen, als ob er dabei gewesen wäre. (Oder meint er doch die Sitten seiner Heimat, des Stadtstaates Hamburg?) Auch schreibt er als Anakreontiker kleine Romanzen, wie sie auch der antike Namensgeber der Dichtung nicht besser hingekriegt hat.
Heute gilt die Anakreontik als albern, kitschig, Weltflucht – ein Sich-Anmaßen der Lebensform einer Unterschicht durch die oberen Zehntausend. Natürlich hatte ein echter Schäfer keine Zeit, bei der Arbeit noch nach dem blanken Busen der Geliebten zu schielen. Das war schon bei Anakreon selber der Fall. Aber wenn wir im Fall von Hagedorn eine derartige Meisterschaft in Inhalt und Form vorfinden, so lächelt das ästhetische Herz doch ein bisschen.
Das eine oder andere Gedicht einmal auswendig lernen und eines Abends in geselliger Runde zum Besten geben – warum eigentlich nicht? Und zumindest ein wenig philosophisch vermag auch Hagedorn zu sein:
Das Dasein
Ein dunkler Feind erheiternder Getränke,
Ein Philosoph, trat neulich hin
Und sprach: Ihr Herren, wisst, wer ich bin.
Glaubt mir, ich bin. Ja, ja! Warum? Weil ich gedenke.
Ein Säufer kam und taumelt’ ihm entgegen,
Und schwur bei seinem Wirt und Wein:
Ich trink, o darum muss ich sein.
Glaubt mir, ich trink: ich bin. Wer kann mich widerlegen?
Wo Hagedorn Recht hat, hat er Recht.