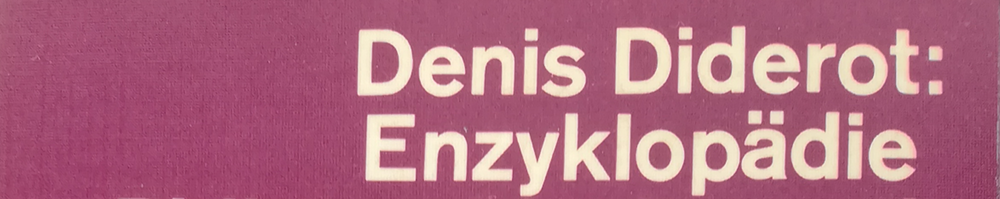Heute haben wir bereits das Ende jener Ära gesehen, die Mitte des 18. Jahrhunderts von Diderot und D’Alembert eingeläutet wurde – die Ära der Enzyklopädie nämlich. Natürlich gab es schon Wörterbücher und Enzyklopädien, bevor die beiden ihre Encyclopédie in Angriff nahmen. Da war selbstverständlich Pierre Bayle mit seinem Dictionnaire historique et critique, aber der unmittelbare Anlass für die Encyclopédie war ein anderer. Es war nämlich der ursprüngliche Plan des Verlegers / Buchhändlers, der Diderot deswegen anging, ein bereits bestehendes englisches Werk einfach zu übersetzen (Ephraim Chambers: Cyclopedia or a universal dictionary of arts and sciences). Bald allerdings war es klar, dass die Artikel von Chambers überprüft, ergänzt oder gar neu geschrieben werden mussten, dass auch vieles ganz einfach fehlte. Also machte sich Diderot daran, neben D’Alembert (der nicht nur Mit-Herausgeber wurde, sondern auch verantwortlich war für alle Artikel, die die Mathematik betrafen) weitere Mitarbeiter zu gewinnen. Schon bald war der Ruhm des Projekts derart, dass auch große Namen der französischen Aufklärung daran mitarbeiteten: Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Holbach, Condorcet oder Condillat, um nur ein paar zu nennen. Eine Enzyklopädie als von Spezialisten zusammengetragenes Wissen der Zeit, gedruckt und (vielleicht gar in Leder) gebunden, als Prunkstück öffentlicher und privater Bibliotheken: Diese Epoche begann mit Diderot. Die Enzyklopädie war (und blieb) ein bürgerliches Projekt. Zur Zeit Diderots, in der Mitte des 18. Jahrhunderts also, wurde sich das Bürgertum gerade seiner selbst bewusst; seine erstarkte ökonomische Bedeutung führte dazu, dass es nun auch Einbezug in die Politik des Landes verlangte. Die Enzyklopädie, die – selbst wenn sie selber kaum offen gegen den absolutistischen Staat argumentierte – nur schon deswegen aufklärerisch und also revolutionär war, weil sie dem Bürger für seine Argumentationen das Wissen der Zeit zur Verfügung stellte, stand so, zumindest indirekt, auch am Anfang der Französischen Revolution, selbst wenn diese, in ihrer Radikalisierung, ihre Väter schon bald verleugnete und verleumdete. Später, und noch bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts, war eine Enzyklopädie (und es gab deren unterdessen mehrere, in allen möglichen Sprachen) immer noch das Mittel des Bürgertums, sich seiner selbst zu vergewissern, indem zum Beispiel Enzyklopädien immer auch den technischen Fortschritt abbildeten, wenn nicht gar verherrlichten. Erst das Internet, das die Form eines riesigen Nachschlagewerks hat, bewirkte das Ende zumindest der gedruckten Versionen der Enzyklopädien. (Dadurch allerdings, dass heute jede/r Dinge ins Netz stellen kann, ist der Anspruch auf eine möglichst korrekte Wiedergabe der Fakten, auf den Diderot so großen Wert legte und den er so einer jeden folgenden Enzyklopädie in die Wiege legte, völlig verschwunden. Heute muss, wer im Internet Informationen sucht, genau das wieder tun, was in Diderots Ab- und Ansicht Sache einer Enzyklopädie war: aufgefundene Informationen abwägen, gegenprüfen.)
Zum Text selber: Ich habe natürlich nicht die ganze Encyclopédie gelesen – immerhin erschienen zwischen 1751 und 1766 elf Bände. Nicht einmal alle Artikel, die Diderot selber geschrieben hat – es sollen über 3’000 gewesen sein. Ich habe mich mit einer Auswahlausgabe begnügt*). Darin ist zunächst und als einer der wichtigsten und längsten Artikel der zum Stichwort Enzyklopädie. Diderot beschreibt hier nicht nur die wesentlichen Eckpfeiler der Zusammensetzung seiner eigenen Enzyklopädie und die Geschichte von deren Zustandekommen, er geht auch auf die Probleme eines jeden derartigen Projekts ein: Abwägen, welches Stichwort überhaupt Platz finden soll, und wenn ja, in welchem Umfang; das rasche Veralten von Informationen (sie veralten quasi unterm Drucken); die Schwierigkeit, von Fachleuten überhaupt gescheite Informationen zu ihrem Fachgebiet zu erhalten (denn Dinge, die den Fachleuten selbstverständlich sind, müssen einem breiteren Publikum erst erläutert werden); last but not least die Koordination der Artikel, im Sinne, dass einerseits Abgrenzungen getroffen und Wiederholungen vermieden werden müssen, andererseits dennoch eine Vernetzung der Artikel gewünscht und notwendig ist. Ein nicht unbeträchtlicher Teil des Artikels zum Stichwort ‚Enzyklopädie‘ ist sogar der Sprache gewidmet – ihrer Orthographie ebenso wie dem Umstand, dass wiederum auch Wörter veralten oder dass ein und dasselbe Wort völlig verschiedene Dinge bezeichnen kann (wie auch umgekehrt ein und dasselbe Ding mit völlig verschiedenen Wörtern bezeichnet werden kann).
In der Folge sehen wir ganz kurz, dass Diderot großen Wert darauf legte, Handwerk und (soweit sie in Frankreich bereits existierte) Industrie vorzustellen. Auf die Landwirtschaft, und darauf, dass den Landwirten genug Geld gelassen wird, damit sie sinnvoll planen können, legt er ebenfalls Wert (wir erinnern uns: der französische Merkantilismus hatte gerade die Agrarwirtschaft völlig ausgeblutet!). Ökonomie und Politik machen überhaupt einen nicht geringen Teil der in meiner Auswahl vorgestellten Artikel aus. (Wie schon gesagt: Die Enzyklopädisten argumentieren sehr vorsichtig und stellen sich ‚offiziell‘ immer hinter den bestehenden Staat. Wo sie ’subversiv‘ werden, handelt es sich nicht um Artikel zum Tehma ‚Staat‘.)
Philosophie definiert Diderot mit Berufung auf Christian Wolff folgendermaßen:
Nach seiner [Wolffs] Ansicht ist sie die »Wissenschaft von den möglichen Dingen, sofern diese möglich sind«.
Je nun. Im Übrigen aber präsentiert sich Diderot in den philosophischen Texten (wiederum: sehr verhalten) als der Sensualist, der er eigentlich ist. Er setzt sich dafür sowohl mit Hobbes, wie mit Spinoza und Leibniz auseinander – auch mit der katholischen Kirche in Form einiger patristischer Autoren. Eigentlich Determinist, plädiert er dennoch für Willensfreiheit und einen Gott – sei es auch nur aus Gründen der Moral. Andererseits verteidigt er den Luxus, der seiner Meinung nach – und da macht sich das aufstrebende Bürgertum bemerkbar – als eine Art Belohnung für moralisch einwandfreies Verhalten betrachtet werden kann.
‚Genie‘ hingegen definiert Diderot auf eine Art und Weise, die auf die Auffassung des deutschen Sturm und Drang vorausweist – und dies, obwohl ich dem Vorwort des Herausgebers entnehme, dass die Encyclopédie zwar sowohl in Frankreich, wie auch in England Furore machte – nicht aber in Deutschland, wo wahrscheinlich nur Herder sie zur Kenntnis genommen hatte. Und vielleicht Georg Forster. Die übrigen deutschen Intellektuellen scheinen kaum Notiz genommen zu haben.
Nicht nur als Zeugnis einer gerade untergegangenen Epoche lesenswert, auch wenn ich niemandem ein Lektüre der ganzen Encyclopédie empfehlen würde. Die von mir gelesene Ausgabe ist zwar nur noch allenfalls antiquarisch greifbar, aber es sind auch im Neuverkauf nach wie vor ähnliche Auswahlausgaben erhältlich.
Denis Diderot: Enzyklopädie. Philosophische und politische Texte aus der ›Encyclopédie‹ sowie Prospekt und Ankündigung der letzten Bände. Mit einem Vorwort von Ralph-Rainer Wuthenow. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, Oktober 1969. [Die dtv-Ausgabe ist eine Auswahl aus den ›Philosophischen Schriften‹, herausgegeben und aus dem Französischen übersetzt von Theodor Lücke, erschienen 1961 im Aufbau-Verlag und 1967 in Lizenz in der Europäischen Verlagsanstalt.]