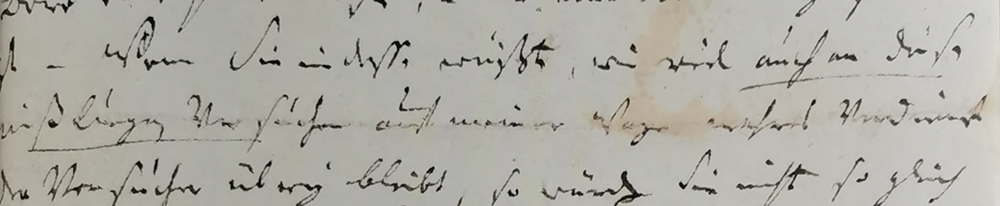Ich habe mir gesagt, dass es sich lohnt, einen über 1’000 Seiten starken Kommentarband zu einem fast 600-seitigen Textband separat vorzustellen. Die immense Arbeit, die in diesem Kommentarband steckt, kann ja selbst so kaum den Meriten entsprechend gewürdigt werden. Immerhin wurde bei jeder der rund 400 Rezensionen der Frankfurter Gelehrten Anzeigen, Jahrgang 1772, die Urheberschaft abgeklärt werden. Das bedeutete zum einen, die Zuschreibungen bisheriger Wissenschaftler zu sammeln und auf ihre Plausibilität zu prüfen, und deshalb zum andern in zeitgenössischen Dokumenten – vor allem Briefwechseln – nach Hinweisen zu suchen: Zeitgenössischen Zuschreibungen durch Dritte ebenso wie (zum Beispiel eben briefliche) Bekenntnisse zu dieser oder jener Rezension. (Einen Spezialfall stellt hierin dann Goethe vor, der – als er sich in den 1820ern schon längst selber historisch geworden war – versuchte, seine Rezensionen auszusondern, um sie in seiner Werkausgabe letzter Hand einzugliedern: Nicht nur, dass er der Meinung war, das Team um Merck hätte auch noch 1773 in den Frankfurter Gelehrten Anzeigen rezensiert – weshalb er sich auch noch aus diesem Jahrgang Texte zuschrieb – er wusste auch sonst nicht mehr so ganz, was er damals geschrieben haben könnte. So eignete er sich Texte an, die heute mit Sicherheit anderen zugeschrieben werden können, oder übersah welche, die man heute ihm zuordnet. Was unter anderem dazu führt, dass auf Grund der Autorität des Meisters – vor allem natürlich in der Goethe-Forschung – nach wie vor unterschiedliche Zuordnungen kursieren.)
Band 2.2 besteht aus dem eigentlichen Editorischen Bericht, einer Geschichte der Frankfurter Gelehrten Anzeigen vom Jahr 1772, inklusive Auflistung der Mitarbeiter, soweit sie identifiziert werden konnten (bei einigen ist es bis heute nicht gelungen), einer Qualifizierung der Texte und anderem mehr. Die darauf folgenden Stellenerläuterungen machen den Hauptteil des Buches aus – runde 750 Seiten. (Weil ich das schon einmal moniert habe: Auch in Band 2 kann sich die Herausgeberin leider nicht enthalten, zum Beispiel unter dem Lemma ‚Zeus‘ nicht nur anzugeben, in welchen Rezensionen der griechische Gott erwähnt wird, sondern auch zu erklären, dass es sich bei ‚Zeus‘ um einen ebensolchen Gott handle. Wie schon einmal gesagt: Ich denke, dass, wer überhaupt einen Mann wie Merck liest, an der deutschen Literatur des ausgehenden 18. Jahrhunderts nicht nur interessiert ist, sondern sich darin auch schon etwas auskennt und deshalb a fortiori über Basiskenntnisse in der – zu jener Zeit auch in der deutschen Literatur noch omnipräsenten – griechischen Mythologie verfügt. Aber dies ist ungefähr die größte Kritik, die ich an Band 2 und an der gesamten kritischen Ausgabe zu üben hätte.) Es folgen Angaben zur benutzen und zitierten Sekundärliteratur, zu den Abbildungen, eine Bibliografie der rezensierten Werke (sehr hilfreich), persönliche Angaben zu deren Autoren, Herausgebern und Übersetzer sowie ein tabellarisches Inhaltsverzeichnis. Alles, was man sich von einer guten kritischen Ausgabe nur wünschen kann.
Die Geschichte der Entstehung und des Wirkens der Zeitschrift im Spannungsfeld von (protestantischer) Orthodoxie in Frankfurt einerseits, aufgeklärtem Denken der Rezensenten andererseits wird ebenso nachgezeichnet, wie die internen Spannungen unter den Rezensenten. Immerhin kann man, so Leuschner, drei Kreise ausmachen, aus denen diese ursprünglich stammen, bzw. mit denen sie immer noch zusammen hängen: einen eigentlich aufklärerisch-wissenschaftlichen, einen empfindsamen Zirkel in Darmstadt, dem Merck und (ephemer) Herder und Goethe zuzurechnen sind, sowie den sich bildenden der Genie-Ästheten (der später „Sturm und Drang“ genannten literarisch-ästhetischen Bewegung) – wiederum mit Merck, Herder und Goethe im Zentrum.
Von den Rezensenten kennt man heute wohl fast nur noch die gerade genannten Goethe, Herder und allenfalls eben Merck. Die übrigen waren zwar (zumindest teilweise) zu ihrer Zeit hochgeachtete Kapazitäten in ihrem Fach – sie sind heute aber vergessene Unbekannte, die höchstens noch hochgradig spezialisierte Universitäts- und Wissenschaftsgeschichten kennen und nennen. Oder ein ebenso hochgradig spezialisiertes Unternehmen wie die Edition einer gelehrten Zeitschrift aus dem 17. Jahrhundert.
Es werden auch die Themengebiete der Rezensionen aufgelistet, und, nachdem ich diese bei der Vorstellung von Band 2.1 mehr oder weniger verschwiegen habe, möchte ich die Auflistung doch kurz reproduzieren, zeigt sie doch ein weitgespanntes Spektrum (Bd. 2.2., S. 21, in der Geschichte der Zeitschrift) wie es für die Zeit der Spätaufklärung typisch war. Es wurden besprochen: 20 historische Werke, 14 politisch-zeitgeschichtliche, 13 gesellschaftskritische (also im weitesten Sinne ebenfalls politisch-zeitgeschichtliche), 3 mit Universitätsgeschichte (einem Spezialgebiet der Wissenschaftsgeschichte), 12 mit Biografik, 7 mit Altertumskunde, 10 Reiseberichte (schon damals Mercks Steckenpferd, aber auch auf dem Buchmarkt waren solche Werke Verkaufsschlager zu jener Zeit, in der man gerade über die eigenen Grenzen hinaus zu blicken und zu denken begann), 1 Werk zur Gartenbaukunst (auch ein Thema, mit dem sich Merck in der nahen Zukünft intensiver befassen sollte). Belletristik machte den Hauptteil aus: 48 deutsche, 24 französische, 23 englische und 15 Werke der klassischen Literatur + 21 Theaterstücke. 10 im weitesten Sinne philologische Werke wurden vorgestellt, 9 sprachwissenschaftliche (inkl. Wörterbücher), 15 konkurrierende oder befreundete Journale. Kunsttheoretische und -geschichtliche Schriften nicht zu vergessen, ebenso die Besprechungen von Kupferstichen. Philosophische Bücher kommen ’nur‘ 20 Mal vor, pädagogisch-didaktische 21 Mal, die neue Physiognomik Lavaters immerhin zwei Mal. 27 juristische und 7 wirtschaftlich-kameralische Texte, davon einer zur Landwirtschaft. In den Naturwissenschaften ist es die auch beim Publikum auf großes Interesse stoßende Medizin, die mit 18 Beiträgen den ersten Rang einnimmt, dann folgen die Mathematik mit 5, Physik mit 4, Chemie und Botanik mit je 3, die Astronomie mit deren 2 und schließlich die Zoologie mit nur einem. Ein breites Spektrum also.
Fazit: Wir mussten lange auf Band 2 der kritischen Merck-Ausgabe warten. Aber es hat sich gelohnt. Diese Ausgabe ist der Beweis, dass kritische Ausgaben auch im 21. Jahrhundert noch möglich und sinnvoll sein können.
Johann Heinrich Merck: Gesammelte Schriften. Band 2.2: Frankfurter Gelehrte Anzeigen vom Jahr 1772 | Kommentar. Herausgegeben von Ulrike Leuschner in Zusammenarbeit mit Eckhard Paul und Amélie Krebs. Göttingen: Wallstein, 2020