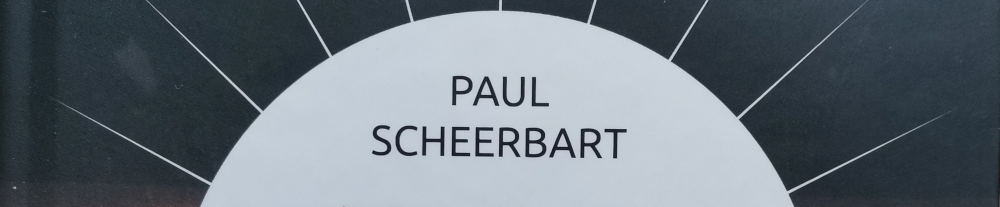Scheerbarts Roman Die große Revolution unter ‚Science Fiction‘ abzulegen ist möglich, aber nicht selbstverständlich. In vielerlei Hinsicht entzieht sich der Mondroman dieser Einteilung – ebenso, übrigens, wie der später entstandene Asteroidenroman Lesabéndio. Für Hardcore SF-Fans sind beide Roman wohl sowieso keine Science Fiction, fehlt ihnen doch das für sie entscheidende Erkennungsmerkmal völlig: die Idee, dass eine Entwicklung von Wissenschaft und / oder Technik das Leben der Menschen so beeinflussen wird, dass daraus eine spannende Geschichte entsteht, die erzählt werden kann. Zwar findet bei Scheerbart eine gewisse technische Entwicklung statt, aber … Ich komme noch darauf. Da in der üblichen Science Fiction solche Entwicklungen natürlicherweise meist in der Zukunft angesiedelt wurden, war im deutschsprachigen Raum lange Zeit die Bezeichnung „Zukunftsroman“ dafür im Schwang. Eher noch werden jene Die große Revolution als Science Fiction betrachten, für die eine Schilderung fremder Welten, bevorzugt nicht-irdischer, schon als Science Fiction gilt. Während Hardcore Science Fiction im Allgemeinen mit Mary Shelleys Roman Frankenstein ihren Anfang findet, haben Reisen zu fremden Welten eine längere Tradition. Schon Lukian schildert eine Reise zum Mond (wo sein Erzähler dann in eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Mondleuten und Sonnenleuten verwickelt wird); Savinien Cyrano de Bergerac reist zum Mond und zur Sonne; Gottfried August Bürger lässt seinen Münchhausen den Mond besuchen; auch Rabelais und Kepler schilderten solche Ereignisse. Die meisten der ‚alten‘ Reisen wurden in satirischer Absicht verfasst und kritisierten in der Schilderung idealer (oder eben völlig missratener) Verhältnisse auf fremden Sternen die Gegenwart ihrer Autoren. Viele waren also, was man im engeren Sinne Utopien (oder Dystopien – aber die waren seltener) nennt. Der Begriff „utopischer Roman“ wurde dann auch auf jede Form von „Zukunftsroman“ ausgedehnt. Am der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert konvergierten Hardcore Science Fiction und Sternenreisen – die Namen Wells und Verne sind bis heute wohl jedem Kind bekannt, sie haben beide (zum Beispiel) spezifische Mondromane geschrieben. (Auch Edgar Rice Burroughs hat, neben seiner bekannteren Marssaga, welche verfasst.) Asteroidenromane wie Lesabéndio sind seltener; allerdings wäre hier Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry zu nennen.
Eine Spezialform des Mondromans verfasste Richard Adams Locke, der, Edgar Allan Poe imitierend, in einer später als „The Great Moon Hoax“ bekannt gewordenen Zeitungsartikelreihe davon fabulierte, dass Sir John Herschel mit einem ungeheuer verbesserten Teleskop Leben auf dem Mond habe ausfindig machen können. Bei Locke wird also nicht gereist.
Und eine noch andere Spezialform haben wir mit Scheerbarts Die große Revolution vor uns (wie auch, mutatis mutandis – nämlich statt des Monds den Asterioden Pallas setzend – mit Lesabéndio). Hier nämlich stehen die Menschen nicht im Mittelpunkt. Sie sind nicht einmal Nebenfiguren, werden nicht einmal handelnd eingeführt. Für die Bevölkerung des Mondes sind sie reine Beobachtungs- und Studienobjekte – wenig geachtete noch dazu. Auch bei Scheerbart ist der Mond also bevölkert. Seine Mondleute haben einen dicken, runden Bauch – eine Art Ballon, den sie aufblasen können und so in der Gegend herum schweben. Bei Bedarf lassen sie die Luft wieder heraus und ankern am Boden mit einer speziellen Technik. Sie leben auch von ihrer Luft und brauchen nichts zu essen. Ebenso wenig pflanzen sie sich fort – und schon gar nicht sexuell. Wenn nach Jahrhunderten ein Mondmann müde wird, begibt er sich in eine spezielle Höhle (Scheerbarts Mond besteht inwendig praktisch nur aus solchen), wo ihr alter Leib langsam abstirbt, während ein neuer aus ihm herauswächst. Im Dialog zwischen altem Mondmann und jungem gibt jener seine Erfahrungen weiter, so, dass der junge Mondmann im Grunde genommen eine identische Replikation des alten darstellt.
Die Die große Revolution nun besteht in Folgendem: Die Mondleute sind nicht gezwungen, irgendeinen Beruf auszuüben. Viele aber haben sich als eine Art Hobby ausgesucht, die Erde und die darauf wuselnden Menschen zu beobachten. Dazu benutzen sie große Teleskope und Fotoapparate, die in praktisch jedem Mondkrater angelegt worden sind. Sie finden zwar die Menschheit eher abstoßend; vor allem der Umstand, dass praktisch jeder Staat auf der Erde ein riesiges stehendes Heer aufweist, ist für sie ein Zeichen äußersten Barbarentums. Irgendwann kommt ein Mondmann (sie heißen bei Scheerbart so, sind aber im Grunde weder Männchen noch Weibchen, weil es ja keine sexuelle Fortpflanzung braucht) – irgenwann also kommt ein Mondmann namens Mafikâsu (auch die Mondleute besitzen seltsame Namen wie die Asteroidenleute) auf die Idee, dass der Mond, dessen Rückseite sie nicht besuchen können, weil es dort keine Luft gibt, ebendort flach ist und im Grunde genommen aus einer einzigen riesigen Glaslinse besteht. Das sollte man sich, findet Mafikâsu, zu Nutze machen und statt der langweiligen und abstoßenden Erdenleute lieber das Weltall mit diesem Riesenteleskop erforschen. Er ist davon überzeugt, dass sich auf anderen Sternen andere Lebewesen finden lassen, die weiter entwickelt und schöner sind als die Erdenleute, ja sogar als die Mondleute selber.
Nach einigen Verwicklungen, in deren Verlauf Scheerbart eine sehr eigenständige (um nicht zu sagen: seltsame) Kosmologie entwickelt, steht das Sternenteleskop tatsächlich, und tatsächlich sind alle Sterne mit solchen Lebewesen bewohnt, ja die Sterne und die Planeten sind selber Lebewesen und keineswegs immer nur kugelförmig – sie können sich auch in Stäbchen oder Würfel verwandeln. Scheerbart lässt hier seinem Panpsychismus freien Lauf. Die Erdenleute aber sind ob der nun gesehenen Schönheit völlig in Vergessenheit geraten. (Eine ähnliche Figur wie Mafikâsu und eine ähnliche ‚technische‘ Entwicklung wie das Riesenteleskop gibt es auch im späteren Roman Lesabéndio, insofern ist sich Scheerbart treu geblieben.)
Weiter zusammenfassen möchte und kann ich den Roman nicht. Wenn man geneigt ist, sich auf seltsamste und nachgerade absurde Ideen einzulassen, wenn man bereit ist, auch mit wenig ‚Action‘ in einem Roman auszukommen, ist Die große Revolution eine sehr vergnügliche Lektüre, die ich nur empfehlen kann.
Paul Scheerbart: Die große Revolution / Lesabéndio. Berlin: Hirnkost KG, 2022. [Lesabèndio habe ich hier schon vorgestellt, und lasse ihn deshalb weg.]
Es handelt sich hier um einen kompletten und mit Liebe gestalteten Neusatz des Textes. Fester Einband, Fadenheftung und Lesebändchen vervollständigen den recht gediegenen Eindruck des Buchs. Man lasse sich auch nicht von dem teilweise in gebrochener Schriftart gesetzten Titel irritieren. Diese Schriftart wird heute häufig von brauner Seite her missbraucht (in absoluter historischer Unkenntnis, nebenbei); hier haben wir aber nichts Derartiges vor uns. Die lila statt schwarz gedruckten Lettern sind allerdings gewöhnungsbedürftig und wären wohl nicht nötig gewesen. Im Übrigen, für Interessierte: Das Buch ist Teil einer auf 40 Bände angesetzten Reihe Utopien in der Science Fiction oder Wiederentdeckte Schätze der deutschsprachigen Science Fiction, die dieses Jahr vom Hirnkost-Verlag begonnen wurde.
Bei diesem Band muss ich aber – leider – noch ein paar Worte zur Gestaltung des vorderen Buchdeckels verlieren. Wie bei allen Bänden der Reihe bisher sind Autorenname, Titel des Romans und Verlag in einer Art großen weißen Sonne in der Mitte des Buchdeckels eingefügt, die Romantitel jeweils in gebrochener Schriftart, wie oben schon gesagt. Nun haben wir das Phänomen vor uns, dass in Lesabéndio ein Vokal mit einem Akzent erscheint, was standardmäßig in gebrochenen Schriftarten nicht existiert. Solche Vokale erscheinen ja im Grunde genommen nur in Wörtern fremder Herkunft, die dann meist in Antiqua gesetzt wurden. Ein ‚é‘ in einer gebrochenen Schriftart ist zumindest gewöhnungsbedürftig.
Wirklich bedauernswert finde ich aber etwas anderes. Hinter der Sonne steht bei jedem Band der Reihe ein Bild, das einen Zusammenhang mit dem Inhalt des Romans hat. Das soll wohl auch hier der Fall sein, ist aber völlig misslungen. Wahrscheinlich war der Grafikerin nicht erklärt worden, worum es ging, und sie vermutete hinter der Großen Revolution so etwas wie die Französische Revolution, die der Menschheit mehr Freiheit brachte. (Während in Tat und Wahrheit Die große Revolution der völlig friedlich verlaufende Wechsel des Beobachtungsschwerpunkts der Mondleute von der Vorderseite (= der Erde) zur Rückseite (= dem Weltall) bedeutet, auch von den Mondleuten so genannt wird.) Den irdischen Begriff der Revolution, den die Grafikerin zu verstehen glaubte, symbolisierte sie nun dadurch, dass sie im Vordergrund ein Gruppe Menschen vor einer Art Nebelsee stellte – wie man ihn in der Schweiz zum Beispiel beobachten kann, wenn man von der Bergen, Alpen oder Jura, an gewissen Herbsttagen ins Mittelland schaut, das in einem solchen See verborgen liegt –, dahinter die strahlend aufgehende Sonne vor einer dunklen Wolke. Die Menschen aber, wie gesagt, spielen im Roman keine Rolle. Statt dessen wäre eine Darstellung der in verschiedenen Farben leuchtenden Ballonwesen des Mondes oder der ähnlich farben- und formenfrohen Wesen vom Asteroiden Pallas gefragt gewesen. Schade.