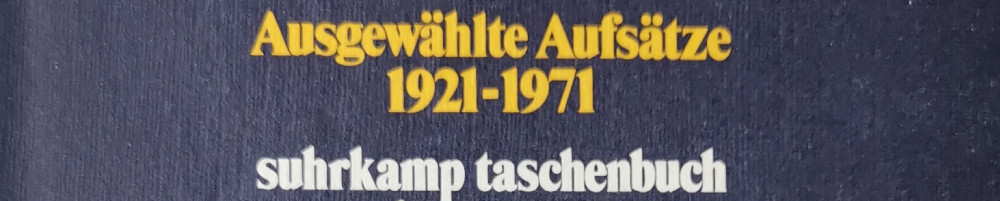Vorliegende Sammlung (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft 262) von Aufsätzen des russischstämmigen Ethnologen und Linguisten Roman Jakobson stammt aus dem Jahre 1979. Sie ist also noch zu Jakobsons Lebzeiten erschienen und mit seinem Copyright versehen, so dass ich davon ausgehe, dass er die Auswahl auch autorisiert hat. Auch heute noch ist sie, in 5. Auflage (als Print on Demand, wenn ich das richtig sehe), im Buchhandel erhältlich.
Jakobson war von Haus aus Ethnologe, hat sich aber früh schon mit seinem strukturalistischen Ansatz eine einzigartige Position erobert im Grenzgebiet zwischen Ethnologie, Sprach- und Literaturwissenschaft sowie Sprachphilosophie. Sein Ausgangspunkt war dabei die Kommunikationstheorie, also Sprache als Zeichen. Er entwickelte das Zeichenmodell Ferdinand de Saussures, bzw. dessen Weiterentwicklung durch Karl Bühler, noch einmal weiter, zu einem Modell, demzufolge an jeder sprachlichen Mitteilung sechs Faktoren und Funktionen (Sprachfunktionen) beteiligt sind. Aus de Saussures einfachem Modell einer Sprache als langue (intersubjektiv geltende Konventionen) und parole (der konkrete Sprechakt – was hier nicht im Sinne John Langshaw Austins verstanden sein will) und dem ebenso einfachen Zeichenmodell des Genfers, in dem signifié das Bezeichnete, den Zeicheninhalt, meint und signifiant das Bezeichnende, bzw. die Bezeichnung, die äussere Zeichenform, entwickelt Jakobson eine Zeichentheorie, in der im Zentrum die Message steht, die von einem Sender an einen Receiver gesendet wird und dabei abhängt von Context, Channel und Code. Anders gesagt:
- Der Kontext, von Jakobson auch referent genannt, ist Voraussetzung dafür, dass die Kommunikation eine referentielle Funktion entfalten, nämlich Inhalte vermitteln kann;
- Die Botschaft kann in ihrer poetischen Funktion selbst zum Thema werden;
- Der Sender, über dessen Haltung zum Gesagten die emotive Funktion Auskunft gibt;
- Der Empfänger, an den die Botschaft über ihre konative Funktion eine Aufforderung senden kann;
- Der Kontakt, in Anlehnung an die Nachrichtentechnik auch physikalischer Kanal genannt, der durch die phatische Funktion der Botschaft aufrechterhalten wird;
- Der Code, dessen wechselseitige Verständlichkeit in der metalingualen Funktion der Botschaft zum Thema wird.
Als primäres Anwendungsgebiet für seine voll entwickelte Zeichentheorie sah Jakobson die Literaturwissenschaft, und so finden wir denn auch in dieser Aufsatzsammlung einige literarische Analysen – leider die meisten davon zu russischer Literatur, für deren Verständnis eine vertiefte Kenntnis der russischen Sprache und Literatur von Vorteil wäre. Einige seiner Resultate, will mir scheinen, sind Phänomene, die schon die antiken Rhetoriker kannten und benannten.
Dennoch lohnt sich eine Lektüre, und ich habe bei meiner hier erfolgten erneuten Lektüre nach … na ja: Jahrzehnten … festgestellt, wie viel ich der strukturalistischen Analyse von Texten bis heute verdanke, wie sehr ich sie immer noch selber anwende. Sie ist eine echte Tochter des Positivismus in ihrem Beharren auf auffindbaren textlichen Fakten. Die Dekonstruktivisten und Poststrukturalisten glaubten, den Strukturalismus wieder (in einer auf Hegel zurückgreifenden Beliebigkeit der dialektischen Logik) aufheben zu müssen. Zum Glück hat er – wenn nicht in der Literaturanalyse so doch mindestens in der (Sprach-)Philosophie – seinen Einfluss nach wie vor geltend machen können.
Wie jede Aufsatzsammlung eher zur punktuellen Lektüre einzelner Abschnitte oder Aufsätze gedacht, aber nach wir vor interessant.