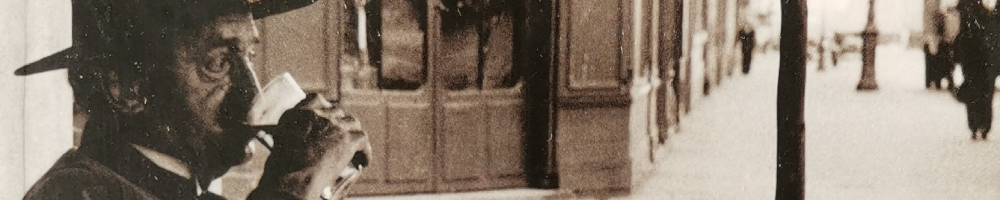Meine Einstellung zu Hemingway ist einigermaßen zwiespältig. Er war der große literarische Held meiner Pubertät – nicht Kafka, wie ich leider gestehen muss, aber zum Glück auch nicht Hesse. Er war der erste, der mir zeigte, dass es neben dem konventionellen Erzählen auch anderes gibt. (Dazu muss ich sagen, dass ich bis heute von Hemingway nur seine Kurz- und Kürzestgeschichten gelesen habe, Der alte Mann und das Meer sowie vorliegendes Fest fürs Leben.) Wie ich älter und vielleicht auch reifer wurde, begannen mich seine Machos und seine Jagdgeschichten zu langweilen. Ich war allerdings noch nicht reif genug, zu erkennen, wie fragil er seine Machos im Grunde genommen darstellt. Auch hatte Hemingways raffinierte, aber sehr karge Sprache für mich ihren Reiz verloren, und ich wanderte weiter zu anderen Autoren. Später habe ich dann meinen Frieden geschlossen mit Hemingway, aber über Jahrzehnte nichts mehr von ihm gelesen oder auch nur wieder gelesen.
Bis mich dann vor kurzem die beiden letzten Teile der U.S.A.-Trilogie von John Dos Passos an das Leben der US-amerikanischen Freiwilligen und später Soldaten in Europa und speziell in Paris erinnerte und an das Konzept der ‚Lost Generation‘, wie es nach dem Krieg in Paris entstanden ist. So habe ich Hemingways Erinnerungen an jene Zeit, A Moveable Feast, wieder hervorgekramt. John Dos Passos kommt darin nicht vor, er war meines Wissens zu der Zeit, die Hemingway hier darstellt, bereits zurück in den USA. Dafür treffen wir (bzw. traf Hemingway im Paris der beginnenden 1920er) auf andere Autoren und Autorinnen:
- Als erste Gertrude Stein: Hemingway lässt sie hier die Geschichte ihrer Autowerkstatt und des ungeschickten Gehilfen erzählen, die der Epoche ihren Namen ‚Lost Generation‘ geben sollte. Daneben versucht Stein Hemingway davon zu überzeugen, dass es nicht nur die brutale Form der Homosexualität gebe, wie sie die (männlichen) US-amerikanischen Landstreicher auslebten, sondern auch eine feinere, zärtliche Form – nämlich die weibliche Homosexualität. (Interessanterweise spricht Hemingway in diesem Buch immer nur von der companion, der Gefährtin Steins, ohne ihren Namen zu nennen – es war wohl Alice B. Toklas.)
- Sylvia Beach. Eigentlich keine Autorin, sondern die Inhaberin der Buchhandlung Shakespeare and Company. Sie veröffentlichte als erste James Joyce’ Ulysses und stellte in ihrer Buchhandlung Hemingways erstes Buch aus (meines Wissens hat es sich trotzdem nicht großartig verkauft). Sie war für Hemingway aber wohl noch wichtiger als Inhaberin einer kleinen Leihbibliothek, der er beitreten durfte, obwohl er seinen Mitgliederbeitrag abstottern musste. So kam er zu seiner Lektüre. Außerdem wird Sylvia Beach mehr als einmal erwähnt, wenn es darum ging, dass die Familie Hemingway wieder einmal ein kurzfristiges Darlehen für dieses oder jenes brauchte.
- Ezra Pound. James Joyce, den Hemingway einmal mit der Familie im Café trifft und mit ihm diskutiert. Ford Madox Ford. Blaise Cendrars, den er für blasiert hält, weil er in Hemingways Augen mit seinem leeren Ärmel kokettiert. T. S. Eliot, aber auch die Maler Wyndham Lewis und Pablo Picasso – wie er überhaupt zu dieser Zeit offenbar ein starkes Interesse an der Malerei hat, das ich sonst von ihm nicht kenne. Last but not least die beiden, denen er am meisten Platz einräumt:
- Scott und Zelda Fitzgerald. Während Hemingway bei den Schilderungen aller anderer seiner Bekanntschaften und Freundschaften in Paris (es sind auch noch andere, weniger bekannte Namen darunter) sich nie einer kleinen hämischen Spitze gegenüber der geschilderten Person enthalten kann (was ich ihm auch vorwerfe und weshalb ich ihn heute nur ungern lese), ist es bei den beiden hier ein wenig anders. Zelda zwar hält er ganz einfach für klinisch verrückt und die Hauptschuldige an der (wie wir heute sagen würden) toxischen Beziehungsform, die die beiden aufgebaut haben. Scott hingegen tut ihm ganz offensichtlich leid.
Den Schluss macht dann ein Kapitel über das österreichische Skigebiet Schruns, wo sich Hemingway und seine erste Frau ein paar Mal im Winter aufhielten. Hemingway führt es ganz offensichtlich ein, um zumindest ansatzweise das Scheitern seiner ersten Ehe thematisieren zu können. (Weil nämlich unter den reichen Leuten, die gerade das heimelige Skigebiet kaputt machen, auch eine junge Frau ist, die ihn, in seiner Darstellung, einfängt bzw. seiner ersten Frau ausspannt.)
Was für ein Leben, bzw. war für ein Fest fürs Leben haben wir hier vor uns? Hemingway spricht immer wieder davon, wie wenig Geld er, seine Frau und der kleine Sohn haben, seit er den Journalismus aufgegeben hat. Dennoch können sie sich Reisen nach Spanien, Italien, die Schweiz und Österreich leisten – ihre Ökonomie besteht offenbar darin, Geld nicht beiseite zu legen sondern auszugeben, wenn es denn da ist. Hemingway wettet auch recht erfolgreich an den Pariser Pferderennen, weil er erkennen kann, welches Pferd wie gedopt ist. Er geht oft ins Café arbeiten und verbringt dann den Morgen dort schreibend und an nur einem Tässchen Kaffee nuckelnd. Oft isst er danach in einem Restaurant; manchmal aber geht er über Mittag auch nur in einem Park spazieren und schildert dann seiner Frau detailliert, was für ein feines Menü er gegessen habe. Zum Essen, nachmittags und abends ist dann Weißwein sein bevorzugtes Getränk, aber auch die lokalen Branntweine verschmähen er und seine Freunde nicht. Neben all diesem, ich habe es bereits angedeutet, schreibt er aber konzentriert und diszipliniert. (Sein Trick: Immer dann aufhören, wenn man genau weiß, wie die Geschichte weitergehen soll.)
Hemingway stellte den Text in seinen letzten Lebensjahren zusammen, dabei offen lassend, wie viel von den erzählten Geschichten Fiktion sei. Er tötete sich selber, bevor das Buch ganz fertig war, und es wurde von seiner vierten Frau Mary in die allgemein bekannte Gestalt gegossen. Dabei hat sie, wie man heute weiß, nicht nur die Kapitel umgestellt, um eine leidlich chronologische Gesamtschau zu erhalten, sondern auch den Schluss (in dem Hemingway sich offenbar bei seiner ersten Frau für sein damaliges, zur Scheidung führendes Verhalten entschuldigt hat) stark verändert – wohl, um als die Gattin Hemingways dastehen zu können. 2009 hat Seán Hemingway, ein Enkel aus der zweiten Ehe, eine restored edition herausgebracht, in der er einige der Änderungen der letzten Ehefrau seines Großvaters rückgängig machte, dafür aber neue einbrachte – offenbar abermals um eine Ehefrau Hemingways zu schonen, dieses Mal seine Mutter, Gattin N° 2. Eine wirklich unabhängige Ausgabe der Texte und Vorlagen gibt es aktuell nicht.
Für meinen Teil habe ich die mir schon lange bekannte Ausgabe gelesen, die erstmals 1964 postum veröffentlicht wurde.
Muss man das Buch gelesen haben?, ist immer meine Frage. Sofern man an der US-amerikanischen Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts interessiert ist: auf jeden Fall. Sofern man am Leben der Bohème in der Stadt Paris der 1920er interessiert ist: ebenfalls. Sofern man Hemingway verehrt, stellt sich die Frage gar nicht erst. Ich halte es für ein literarisch gut gemachtes Stück Erinnerungsliteratur, in der man zumindest Hemingway findet, wie er leibt und lebt. Was auch heißt: Immer bereit, einer Schilderung einer Person eine negative, fast hämische Prise Ironie beizugeben. Was auch bedeutet: Ich werde mich mit Hemingway wohl nicht mehr befreunden. Es geht mir so, wie es Hemingway mit Gertrude Stein ging: Nachdem die Freundschaft einen Kratzer hatte und die beiden sich längere Zeit aus dem Weg gingen, konnten sie zwar später wieder einen an die alte Freundschaft erinnernden gesellschaftlichen Verkehr aufnehmen – aber Freundschaft war es, zumindest für Hemingway, nicht mehr. Freundschaft ist es, zumindest bei mir, auch nicht mehr.