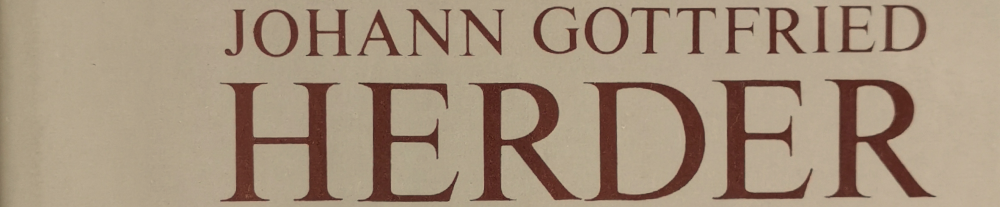Italien. Warum Herder dorthin fuhr, was er sich davon erwartete – aus seinen Briefen geht es nicht hervor. Vielleicht war es, weil halb Weimar in den Süden reiste – ‚man‘ fuhr halt gerade weg. Wahrscheinlich war es Goethes enthusiastische Reaktion auf das Land, in dem die Zitronen blühen, die die Zurückgebliebenen triggerte. Da war, neben Herder, auch die Herzogin Anna Amalia und – ein bisschen abenteuerlicher – Johann August von Einsiedel, den es noch weiter in den Süden zog, nach Afrika.
Herders Reise begann nun nicht sehr glücklich. Es war abgemacht, dass er als Begleiter und auf Rechnung des Domkapitulars Johann Friedrich Hugo von Dalberg reisen sollte. Doch im letzten Moment schloss sich dessen Geliebte, die verwitwete Frau von Seckendorff der Gruppe an – angeblich, um Dalberg behilflich zu sein, nicht zu viel Geld auszugeben, tatsächlich wohl eher aus Eifersucht auf den Männerbund Dalberg-Herder. (So lässt es sich jedenfalls aus den Briefen des unglücklichen Herder interpolieren, deren Darstellung ich auch im Weiteren folge.) Sie versuchte mit allen Mitteln, Herder die Reise zu vergällen, ihn aus dem ‚Team Dalberg‘ auszuschließen. Hinzu kam, dass Herder Goethes Darstellung, wonach man in Italien wenig (Materielles) brauchte, um glücklich zu sein, allzu wörtlich genommen hatte. Bereits im Süden Deutschlands, aber doch zu spät, realisierte er, dass es einen Unterschied machte, ob man zuerst wie vom Teufel gehetzt mit Eilpost nach Italien flüchtete und dann dort als einfacher Maler in der deutschen Künstlerkolonie lebte, oder ob man als Kirchenfürst unterwegs des öfteren Halt machte, um anderen Eminenzen Besuch abzustatten. Herder hatte keine Repräsentationskleidung dabei; erst in Rom ließ er sie sich (für teures Geld) schneidern.
Es wurde ihm also gleich zu Beginn ein großer Teil seiner Reise verdorben. Da half ihm auch der fleißige Besuch von Bibliotheken und Kunstsammlungen wenig. Erst als es ihm gelang, sich von Dalberg zu lösen und das ihm zustehende Gehalt doch noch zu erhalten, er also von den Launen der Frau von Seckendorff unabhängig wurde, ging es ihm besser. In Rom schloss er sich dann der ebenfalls dort residierenden Anna Amalia an – und musste erleben, dass ihn Luise von Göchhausen, die als deren Hofdame für deren Finanzen zuständig war, nun ihrerseits scheel anblickte. Das Verhältnis der beiden besserte, als sich Herder als finanziell unabhängig herausstellte.
Die Wege von Anna Amalia und Herder trennten sich dann tatsächlich wieder. Herder ging alleine nach Neapel, wo er, oft in Gesellschaft der Malerin Angelika Kauffmann, seinen Aufenthalt erst genießen konnte. (Herder, nebenbei, war entweder sehr naiv oder er konnte seine Frau sehr genau einschätzen, wenn er in seinen Briefen an sie von dieser Angelika als einer wirklich engelsgleichen Frau schwärmte.)
Auf der Rückreise (sein ihm vom Herzog Carl August gewährter Urlaub neigte sich dem Ende zu) kreuzte er nochmals die Gruppe um Anna Amalia, die jetzt erst nach Neapel reiste, um später noch Sizilien zu besuchen (das Herder also, anders als Goethe, nicht sehen würde). Ansonsten verlief die Rückreise arm an äußeren Ereignissen, dafür desto reicher an inneren. Unterdessen war nämlich an der Universität Göttingen abermals ein Professor der Theologie gestorben und man wandte sich für die Nachfolge abermals an ihn. Der Briefverkehr wickelte sich größtenteils über Caroline in Weimar ab, und es ist an Hand der von Johann Gottfried stammenden Briefe nur schwer zu entscheiden, wer nun wem was versprochen hatte. Auch ein Brief Carolines an Heyne (der abermals den Mittler machte) erhellt die Geschehnisse nicht. Herder scheint praktisch schon zugesagt zu haben, als er erfuhr, dass Herzog Carl August von Weimar (auf Goethes Betreiben, wie wir aus anderen Quellen wissen) ihm eine Promotion und eine Lohnerhöhung zusprach, zusammen mit dem Versprechen, dass Zahl der von ihm zu haltenden Predigten verkleinert würde. Herder windet sich deshalb aus seiner halben Zusage an Heyne heraus. (Weder bei Dalberg noch bei Heyne schadete Herders Verhalten übrigens der gegenseitigen Freundschaft.) Einem anderen Briefpartner sollte er kurze Zeit später, wieder in Weimar, eine Professur in den schwärzesten Farben hinstellen – was ihn dennoch nicht daran hinderte, seine Chancen vorsichtig zu sondieren, als in Jena eine solche frei wurde …
Ansonsten ist an Herders Italienreise vielleicht noch zweierlei bemerkenswert. Da sind zum einen die Briefe an seine Söhne, in denen er ihnen – auf ihre persönlichen Interessen abgestimmt – erzählt, was er so alles gesehen hat. Sprachlich einfacher gehalten als seine ‚erwachsenen‘ Briefe, sind sie dennoch nicht kindisch und auch, was seine Schilderungen betrifft, hält er mit der Wahrheit keineswegs zurück, auch wenn er nicht in gewisse Details geht. So sollte gute Kinderliteratur beschaffen sein. Auf der anderen Seite fällt auf, wie tief und breit zumindest für deutsche Besucher Goethes Fußstapfen in der kurzen Zeit geworden waren, seit dieser von dort weg war. An allen Ecken und Enden trafen Herder wie Anna Amalia auf Leute, die Goethe gekannt hatten. Tischbein ließ ihm Grüße ausrichten; Moritz und Meyer dienten auch diesen Weimarern als Führer, selbst Hirt lief ihnen über den Weg.
Zurück in Weimar setzten schon bald die alten Klagen und Probleme wieder ein. Damit meine ich nicht die kurze Erwähnung des Übersetzer-Kriegs um die Odyssee sondern zum Beispiel die Französische Revolution. Obwohl Herder sich zu der Zeit, als Goethe mit seinem Herzog auf der Campagne in Frankreich war, ebenfalls gerade an der Westgrenze Deutschlands aufhielt, wird die Revolution in seinen Briefen nur am Rande erwähnt und selbst dann sehr verklausuliert. Schiller wird ebenfalls nur ‚übers Eck‘ erwähnt, in Form der wie ihre Schwester ebenfalls in Schiller verliebten Caroline von Lengefeld (spätere von Wolzogen). Ebenso druckst Herder herum, als es um eine Geburt im Hause Goethe geht: Weder der Name von Christiane Vulpius (deren Beziehung zu Goethe die bessere Gesellschaft von Weimar nicht billigte, wohl auch für vorübergehend hielt) noch der Name des Sohnes werden erwähnt. Last but not least stammt aus der Epoche, die dieser Band der Herder’schen Briefe abdeckt, ein weiteres Problem – eines allerdings, das sich erst später als Dorn im Auge der Weimarer Gesellschaft entpuppen würde. Wir reden von der Berufung Karl August Böttigers als Direktor des Weimarer Gymnasiums. Er würde sich mit seinen neugierigen Augen rasch unbeliebt machen, aber im Moment schwärmte Herder noch von dessen pädagogischen Fähigkeiten.
Den wankelmütigen Mann nun kennend, stellt sich natürlich die Frage: Ist Herder nach Weimar zurück gekommen mit dem festen Willen, zu bleiben?