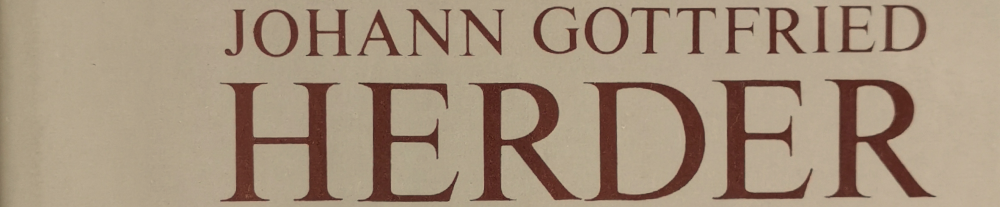Herders letzte Jahre waren seine glücklichsten nicht. Er hatte ja schon immer die Begabung, sich unglücklich und missverstanden zu fühlen. Bei jedem Versuch, dem zu entkommen, redete er sich schon bald ein, vom Regen in die Traufe gekommen zu sein. Unglücklich als reisender Hofprediger rettete er sich nach Bückeburg. Vom schlechten Verhältnis zu seinem Landesherren unglücklich gemacht, kam er nach Weimar. Aber auch dort wurde er nicht glücklich. Eine Wahl zum Professor in Göttingen lehnte er im letzten Moment ab, weil man im bessere Konditionen in Weimar versprach. Das trat dann – jedenfalls seiner Meinung nach – nicht ein. Er fühlte sich veräppelt und reagierte entsprechend.
Nun also ist sein Verhältnis zum Herzog von Weimar endgültig zerstört. Allerdings weiß Herder, dass er unterdessen zu alt ist, um noch irgendwo anders unterzukommen, was ihm den bisher immer gewählten Ausweg verbarrikadiert. Das zerstörte Verhältnis zum Herzog wirkt sich auch aus auf sein Verhältnis zum früheren Freund Goethe. Es sind denn auch nur wenige und meist kalte Briefe überliefert. Selbst mit Schiller, vielleicht weil der ja selber ein wenig fremdelte in Weimar, verstand er sich in seinen letzten Jahren besser als mit Goethe, und er schickte ihm noch die eine oder andere Kleinigkeit für dessen Musenalmanach. Einzig mit Wieland stand er sich gut. Nicht nur, dass er auch ihm das eine oder andere für den Teutschen Merkur schickte oder vermittelte – die beiden hatten auch ganz konkret dieselben Probleme.
Womit wir bei einem weiteren Punkt sind, der Herder unglücklich machte. Außer dem jüngsten, Rinaldo, waren nun alle seine Söhne mit ihrer Ausbildung fertig und suchten Arbeit. Da konnten sich er und Wieland, der vor demselben Problem stand, gegenseitig helfen. Mehr noch: Herder wie Wieland hatten mindestens einen Sohn, der über einen recht lockeren Umgang mit Geld verfügte, konkret gesagt: der Schulden machte, die dann wiederum von Papa und Mama gedeckt werden mussten. (Wieland wie Herder – bzw. Caroline – mit der brieflichen Anmerkung an den Sohn, dass man den missratenen Sprössling in Zukunft in der Misere sitzen lassen wolle und müsse.) Auch keine erfreuliche Situation.
Vielleicht, weil ein geografisches Ausweichen, ein neuer Job, nicht mehr möglich war, ging Herder gewissermaßen in die innere Emigration und zog sich auf eigene Projekte zurück. Da war einerseits, 1799, was später als Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft bekannt werden würde. Herder setzte sich da in einen Gegensatz zur meist positiven Rezeption von Kants wichtigstem Werk. Unter anderem damit brachte er aber auch die Jenaer Romantiker gegen sich auf, die damals noch recht Fichte-hörig waren. Mit spürbarer Genugtuung berichtet er über der Entfernung Fichtes von der Universität Jena – später auch mit ebenso spürbarer Genugtuung vom Skandal um die Aufführung von August Wilhelm Schlegels Drama Ion, das ja bis heute weniger auf Grund eigener Qualitäten berühmt ist, als wegen der für die damalige Zeit ungewöhnlichen Inszenierung durch Goethe selber und der daraus resultierenden Theaterkritik Böttigers, deren Druck in einer der Weimarer Zeitschriften Goethe selber verhinderte (Böttiger wich der Zensur Goethes aus, indem er die Kritik schlussendlich im Ausland drucken ließ – in Sachsen-Gotha, wenn ich mich recht erinnere). Was Herder wiederum mit Böttiger, mit dem er sich auch zerstritten hatte, versöhnte.
Der Kreis seiner Freunde wurde auch aus anderen Gründen enger. 1799 verstarb Lichtenberg, im Folgejahr Kästner. Damit fielen zwei wichtige Männer weg, die Herder noch mit der Aufklärung – aus der er letzten Endes stammte und der er letzten Endes angehörte – verbunden hatten. Im Februar 1803 starb dann im hohen Alter von 83 Jahren der lebenslange Freund Gleim. Herders Vereinsamung nahm zu.
Natürlich hatte Herder immer noch Freunde. Da ist zuvorderst zu nennen Jean Paul, der Herder regelmäßig in Weimar besuchte – selbst dann noch, als er selber verheiratet war, denn seine Frau blendete sich hervorragend in die Zirkel ihres Mannes ein. Auch zu Knebel bestand nach wie vor ein gutes Verhältnis. Ja, die drei planten sogar die Herausgabe eines eigenen literarisch-historischen Magazins. Schlussendlich aber blieb Herders Name als einziger auf dem Titelblatt der Adrastea, und auch ein Großteil der Arbeit für diese Zeitschrift blieb an Herder hängen. So misslang letzten Endes die beabsichtigte öffentliche Positionierung gegen die klassizistische Strömung in Weimar-Jena.
Wenn wir nun noch erwähnen, dass Herder den Anfang jener Eroberung Europas durch Napoléon noch erlebte und sich Sorgen machen musste um das Schicksal seiner Schweizer Freunde, wird man verstehen, dass die immer wieder auftretenden Krankheiten, die Herder plagten, nur noch der letzte Stein waren, Herder niederzudrücken. Was es genau war, das ihn plagte, ob immer wieder neue Krankheiten oder immer dieselbe mit jeweils anderen Symptomen, weiß ich nicht. Zwei Mal wurde Herder eine Bäderkur verordnet, die beide Male auch kurzzeitige Besserung brachten. Als seine Familie gerade glaubte, er sei wieder auf dem Weg zur Besserung, verstarb Herder am 18. Dezember 1803.