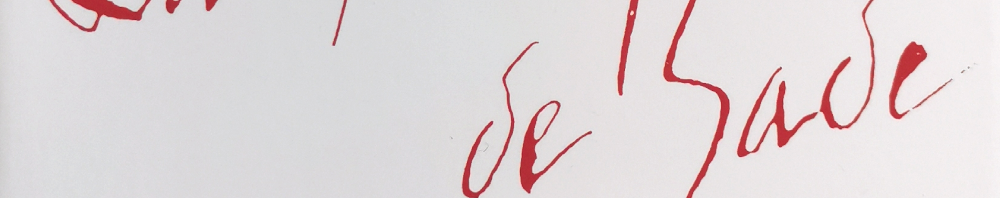Rachilde ging auf ihr 30. Lebensjahr zu, als sie kurz hintereinander drei Romane veröffentlichte, die ihren Ruf als Skandalautorin bildeten und festigten: Monsieur Vénus 1884, La Marquise de Sade 1887 und Madame Adonis 1888. Eine zweite Auflage des Monsieur Vénus, ohne die Teile ihres ursprünglichen Co-Autors Francis Talman, erschien schließlich im Jahr 1889. Da ich vor kurzem diese letztere Version vorgestellt habe, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass ich die drei Romane in verkehrter Reihenfolge gelesen habe. Das spielt aber an und für sich nicht einmal eine große Rolle; in allen drei Romanen sieht man eine Autorin, die noch nach ihrem Stil sucht, auch wenn sie – zumindest vorläufig – ihr Thema schon gefunden hat.
Monsieur Vénus wurde ursprünglich geschrieben um des Skandals willen, um Aufmerksamkeit zu erregen. (Was ja auch gelungen war.) Stilistisch recht neutral, lebt er vor allem von seinem Inhalt: der Schilderung einer seltsamen Liebe und – zumindest bis dahin – in der Literatur wenig geschilderter Sexualpraktiken. In Madame Adonis kopiert Rachilde über weite Strecken den berühmten Gustave Flaubert – nur, dass die außerehelichen Eskapaden ihres die Hauptrollen spielenden Ehepaars mit ein und derselben Person stattfinden, die dann tentativ bi- und transsexuell beschrieben ist.
La Marquise de Sade zieht noch einmal andere Register. Es kommt zwar auch hier eine homosexuelle Frau vor, aber erst spät und sie spielt keine tragende Rolle. Der Titel, ganz eindeutig abermals gewählt um des Skandals willen, führt sogar in die Irre. Es handelt sich hier weder um eine Biografie der Gattin des berüchtigten Donatien Alphonse François de Sade noch um einen Roman im Stil zum Beispiel der ebenso berüchtigten Justine dieses Autors.
Wir können den Roman in drei ziemlich genau gleich lange Teile unterteilen. Der erste Teil erzählt die Kindheit der Protagonistin Mary Barbe, der zweite ihre Adoleszenz, der dritte ihr Leben als junge Erwachsene. Vor allem im ersten (und auch ein wenig im letzten) Teil macht sich der naturalistische Einfluss Émile Zolas bemerkbar. Ähnlich wie in den auf dem Land spielenden Teilen von dessen Roman-Reihe Les Rougon-Macquart, finden wir eine keineswegs idyllische Vorstellung vom Leben dort. Mary Barbe ist die Tochter eines Offiziers, der mit seinem Regiment in Frankreich von Ort zu Ort versetzt wird. Gleich die Eröffnungsszene zeigt uns die etwa Vierjährige, wie sie erleben muss, dass ein Stier auf dem Bauernhof getötet wird, damit ihre kranke Mutter ein bestimmtes Quäntchen frisches Blut kriegt. Denn die Mutter ist ziemlich krank und hat kaum Zeit oder Kraft, sich im ihre Tochter zu kümmern. Dieses ganze erste Drittel ist sehr autobiografisch geprägt; auch Marguerite Eymery, die sich als Autorin Rachilde nennen sollte, war Tochter eines französischen Offiziers, der sie mit jener Strenge erzog, die schon damals üblicherweise den Söhnen vorbehalten war – regelmäßige Auspeitschungen inklusive. Kein Wunder, lässt die Autorin kein gutes Haar an Mary Barbes Vater. (Die Mutter in ihrer Schwäche scheint Mary Barbe irgendwie zu lieben, aber die Autorin schreibt sie relativ schnell aus der Geschichte heraus, indem sie sie im Kindbett sterben lässt.)
Der Tod ist sowieso ein steter Begleiter der Mary Barbe. Im Lauf des Romans werden ihre Lieblingskätzchen von fanatischen Bigotten getötet, weil Mary nicht so gläubig wird wie sie. Ihre Mutter stirbt bei der Geburt ihres Brüderchens; dieser wird später sterben, weil sich seine Amme stockbesoffen quer über ihn legt und ihn erstickt. Die erste schüchterne Jugendliebe stirbt an einer Lungenentzündung, die der junge Mann sich geholt hat, als er ihr im Frühling über einen eiskalten Fluss geholfen hat. Die Zeit mit Siroco (wie er hiess) war denn auch die letzte idyllische Zeit Mary Barbes (eine Episode, die nicht zufällig zu einem beträchtlichen Teil in einem Rosengarten spielt, aus dem sie der Tod Sirocos vertreibt).
In ihre Adoleszenz fällt unter anderem auch der Deutsch-Französische Krieg. Das gibt der Autorin die Gelegenheit, sich über den aufflammenden Patriotismus in der französischen Provinz lustig zu machen, wo der Vater der Protagonistin gerade stationiert ist. Hinter jedem Baum wird ein deutscher Spion vermutet, und als die Soldaten dann an die Front ausrücken, wird das mit einem riesigen patriotischen Fest gefeiert. (Seltsam genug, dass die Autorin, als 1919 der Prix Goncourt an Marcel Prousts À l’ombre des jeunes filles en fleurs ging, sich auf die Seite jener stellte, die Proust vorwarfen, nicht mehr zeitgemäß zu sein und lieber seinen Gegenspieler preisgekrönt gesehen hätten, der einen vor Patriotismus triefenden Roman vorgelegt hatte, der die Worte und Taten der französischen Soldaten im Weltkrieg verherrlichte. Was für ein Unterschied zwischen den Worten der 27-Jährigen und den der fast 60-Jährigen! – Persönlich ist mir die 27-Jährige mit ihrer beißenden Satire über den Nationalismus lieber.)
Im Deutsch-Französischen Krieg fällt dann auch Marys Vater. Sie kommt zu einem Onkel, einem bekannten Naturforscher, der in Paris lebt. Dort wird Mary zur Erwachsenen und erlebt, wie ihre aparte Schönheit die Männer betört. Längst durch ihre bisherigen Erlebnisse verhärtet, beschließt sie, sich nunmehr an der Welt, der Menschheit, den Männern, zu rächen. Dieser Entschluss wird eingeleitet durch einen kurzen Monolog, der in seiner Misanthropie von Schopenhauer hätte stammen können. (Der Einfluss dieses deutschen Philosophen auf Rachilde wäre zu untersuchen.) Damit ist der Übergang zum dritten und letzten Teil vorgegeben. Erst, im dritten Teil, wird Mary zur Marquise de Sade – zur Männer verachtenden, Männer beherrschenden, Männer zerstörenden und tötenden Frau. Sie wird allerdings nicht zu einer Sadistin im heutigen Verständnis des Worts – ob Mary überhaupt zu sexueller Lust fähig ist, lässt Rachilde offen. Liebe? Vielleicht. Da war Siroco und später ist da der uneheliche Sohn ihres bedeutend älteren Mannes. Einzig gegenüber ihrem Gatten könnte man von einem gewissen Sadismus sprechen. Der hat Mary schon früh in der Ehe mit anderen Frauen betrogen und versucht gar, ihre Finanzen (sie ist durch ihren Onkel zu einem gewissen Vermögen gekommen) zu kontrollieren. Sie verlässt ihn zunächst, rächt sich aber dann an ihm, indem sie sich zum Schein wieder mit ihm versöhnt (dass es zum Schein war, erfahren wir Lesenden aber erst im Nachhinein), sich (ebenso zum Schein?) in eine sexuell unersättliche Frau verwandelt und ihn nun jede Nacht besitzen will. Seine Potenz reizt sie auf, indem sie ihm große Dosen an Kanthariden-Pulver verabreicht – so große in der Tat, dass er an Priapismus stirbt. Das ist aber der einzige Akt, bei dem man von einem gewissen Sadismus im modernen Sinn sprechen könnte. Ansonsten wäre ein Vergleich mit Gil Blas vielleicht angebrachter (wie ihn die Autorin übrigens auch bildet), dem Ich-Erzähler und Protagonisten, Sohn eines Stallmeisters und einer Kammerzofe, im gleichnamigen Roman von Alain-René Lesage, der in seinem gesellschaftlichen Aufstieg an Mary erinnert und auch sonst in der Schreibweise die verschiedensten Milieus von ganz unten bis ganz oben satirisch-kritisch vorführt. In Bezug auf Marys Charakter ähnelt ihr wohl mehr noch der echte Gilles de Rais, genannt „Blaubart“, nämlich was die blutige Spur betrifft, die die junge Frau in ihrem Leben hinterlässt.
Dabei erfahren wir gar nicht ihr ganzes Leben. Wir verlassen die Protagonistin nämlich ungefähr zu Beginn ihres 30. Lebensjahres, im Alter ihrer Autorin also. Marys einziges Vergüngen im Leben scheint es nunmehr zu sein, andere Leute (vor allem Männer) umzubringen. Ob Mary damit, wie die Protagonisten in den Erzählungen des Marquis de Sade oder eben auch der echte Gilles de Rais, sexuelle Lust verknüpft, lässt Rachilde offen, scheint es aber dann doch ganz leise zu suggerieren.
Summa summarum: Wir erleben hier eine Autorin auf der Suche nach ihrem Stil. Das bedeutet nicht, dass der Roman wertlos ist. Im Gegenteil: Die scharfe Karikatur des Militärs und überhaupt der Gesellschaft unter Napoléon III ist allemal lesenswert und zeitlos. Die psychologische Entwicklung der Protagonistin überzeugt. Um es im Stil moderner Buchhandlungswerbung zu formulieren: Wer den Naturalismus eines Émile Zola mag, wird mindestens auch die Schilderung der Kindheit Mary Barbes mögen. Und mehr.
Es gibt meines Wissens keine deutsche Übersetzung dieses Romans. Der französische Text ist im Internet abrufbar oder als Taschenbuch in der Reihe L’Imaginaire Gallimard als N° 342 erhältlich, dies mit einem Vorwort von Edith Silve, erschienen 1996, wieder aufgelegt 2014.