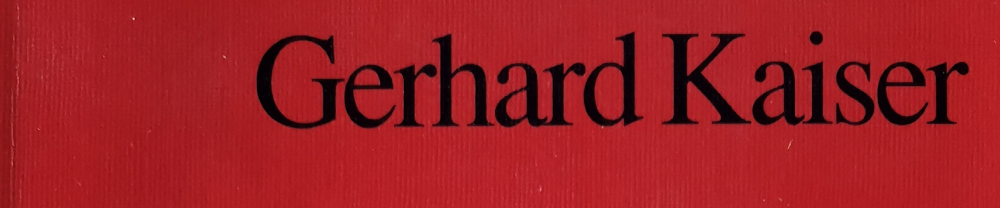Dieses Buch habe ich vor einiger Zeit im lokalen öffentlichen Bücherschrank gefunden (wohin ich es später auch wieder zurückstellen werde). Es erschien zum ersten Mal 1976 in der Reihe UTB, einer Reihe, die um jene Zeit herum von verschiedenen kleineren und mittleren Verlagen gegründet wurde, welche – einzeln zu schwach – gemeinsam in den Markt der Literatur für Studierende verschiedenster Fächer einzudringen wünschten, um diesen profitablen Geschäftszweig nicht ganz den großen Verlagen überlassen zu müssen. Das Unternehmen war offenbar von Erfolg gekrönt; jedenfalls existiert die Reihe bis heute, wenn auch einige der teilnehmenden Verlage geändert haben. Diesen Erfolg kann man auch am vorliegenden Buch ablesen: Es erschien 1996 noch in 5. Auflage. Das war dann allerdings bereits die vorletzte, es folgte noch eine sechste, aber heute ist Kaisers Buch im UTB-Katalog nicht mehr zu finden.
Nun hat sich der Fokus der Reihe seit deren Gründung in meinen Augen auch verschoben. Ursprünglich gedacht als ein Ort für thematische Einführungen und wichtige Primärtexte der einzelnen Wissenschaften, liegt der Brennpunkt meines Erachtens heute eher bei methodologischen Einführungen. Anders gesagt: Nicht mehr Fragen zum Was? stehen im Vordergrund der Reihe sondern Fragen zum Wie?. (Wie schreibe ich eine Facharbeit? etc.) Ich finde das schade; es mag aber auch der Verschulung vor allem der geisteswissenschaftlichen Fächer durch die Bologna-Reform geschuldet sein.
Kleine Randnotiz: Im von mir gefundenen Buch sind die ersten rund 50 Seiten – nämlich die vier Kapitel: Einheit der Epoche, Die Aufklärung, Die Empfindsamkeit und Das Bürgertum als kulturtragende Schicht – offenbar tapfer durchgearbeitet worden; jedenfalls finden sich Markierungen mit Leuchtstift und handschriftliche Randnotizen. Danach war dann entweder der belegte Kurs bereits zu Ende oder der Fleiß der lesenden Person – jedenfalls sind die restlichen rund 350 Seiten jungfräulich geblieben …
Zum Inhalt:
Gerhard Kaiser war eine Koryphäe und ich beabsichtige nun keineswegs, seine Geschichte der deutschen Literatur von der Aufklärung bis zum Sturm und Drang nachzuerzählen. Typisch für die Entstehungszeit des Buch, die frühen 1970er also, fehlen schreibende Frauen auch da, wo es sie gegeben hätte. Allenfalls werden sie als mindere Randfiguren erwähnt. Ich vermute, das war mit ein Grund, warum das Buch heute nicht mehr aufgelegt wird. Darüber muss man also hinwegsehen.
Andere ‚Randfiguren‘ werden aber dann doch mit ein paar Worten bedacht – so Lichtenberg, Jung-Stilling, Bräker und andere Autobiographen im Kapitel Seelenanalyse, Autobiographie und Roman, dazu noch Moritz, Hippel, F. H. Jacobi und Heinse. Pestalozzi erscheint als eine der verwandte[n] Tendenzen des Göttinger Hains. Auch sonst ist Kaisers Literaturgeschichte im Großen und Ganzen traditionell aufgebaut – mit Personen und Persönlichkeiten im Mittelpunkt.
In anderer Hinsicht war er wegweisend. Die Antike kriegt unmittelbar nach dem oben erwähnten Kapitel zum Bürgertum ein eigenes Kapitel, und das ist gut so. Die Wichtigkeit der Antike schon für die Autoren der Empfindsamkeit (z.B. die Anakreontik!) kann nicht genug betont werden – sie wird sonst vor allem bei der (in diesem Buch nicht mehr behandelten) Weimarer Klassik ins Licht gesetzt.
Von den ganz großen Namen der Zeit wird Herder seltsamerweise nur am Rand gestreift. Das Wieland gewidmete Kapitel wird seinem Namensträger, finde ich, nicht gerecht. Es fällt aber auf, dass die im übrigen Text auffindbaren Bemerkungen zu Wieland bedeutend besser, weil treffender, gelungen sind. Für mich dennoch ein großes Manko: es wird in meinen Augen aber ein wenig aufgewogen durch den Abschluss, eine sehr schöne und unaufgeregte Darstellung von – Georg Forster. Die hätte ich nicht erwartet in einer Literaturgeschichte von bloß einmal 300 Seiten (wenn wir Anmerkungen und Literaturverzeichnis nicht zählen).
Der wissenschaftliche Stand muss gemäß einem Vorwort des Autors der von ca. 1979 sein, da er danach den Text nicht mehr überarbeitete (weil sich seine Interessen, schreibt er, verschoben hätten). Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man dieses Buch in die Hand nimmt. Das spielt meines Erachtens eine kleine Rolle hier (wenn wir einmal vom oben erwähnten Problem der Sichtbarkeit von Autorinnen absehen). Ich bin aber vielleicht nicht ganz neutral, spiegelt Kaisers Literaturgeschichte doch in Inhalt und Darstellung die Germanistik wieder, wie sie war, als ich sie kennen lernte und wie sie wohl tief in mir nach wie vor verankert ist.
Gerhard Kaiser: Aufklärung, Empfindsamkeit, Sturm und Drang. Tübingen / Basel: A. Francke, 5. [gegenüber der 3.] unveränderte Auflage, 1996. (= UTB 484)