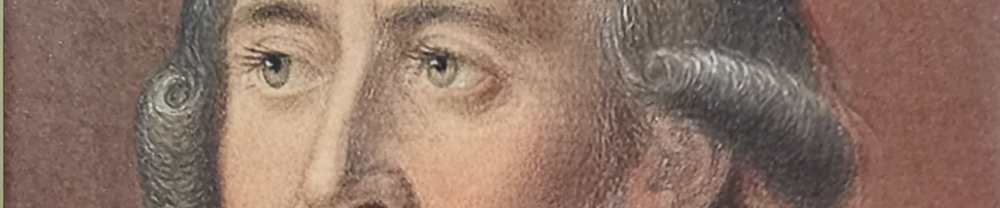Armer Bürger! – Mit diesem Ausruf habe ich damals meine Vorstellung des zweiten Bands des Briefwechsels von Gottfried August Bürger angefangen. Und mit: Armer Bürger! muss ich auch dieses Aperçu über Band III einleiten. Denn im Grunde genommen hat sich wenig geändert für Bürger in dem Jahrzehnt von 1780 bis 1789 und seine Situation, sein Leben, sind nach wie vor so elend wie in den drei Jahren von 1777 bis 1779.
Zwar hat sich sein Verhältnis zu seinen Freunden wieder normalisiert. Selbst Voß, mit dem er sich am meisten zerstritten hatte, würde gegen Ende der in Band III vorgestellten zehn Jahre für die zweite, vermehrte Auflage von Bürgers Gedichten subskribieren, nachdem er bei der ersten Auflage noch seine Frau vorausgeschickt hatte. Und dies, obwohl Bürger ihn in den frühen 1780ern noch einmal tüchtig geärgert hatte. Voß nämlich schickte sich gerade an, den ersten Band seiner Übersetzung der Geschichten aus Tausendundeiner Nacht zu veröffentlichen, als Bürger ankündigte, seinerseits eine solche Übersetzung ins Deutsche herauszubringen – und zwar eine bessere als alle andern bisherigen. Mit diesen andern bisherigen konnte nur die von Voß gemeint sein – eine weitere gab es nicht auf dem Markt. (Beide Autoren übrigens übersetzten natürlich nicht aus der Originalsprache sondern aus der kürzlich erschienenen Übersetzung des Franzosen Galland in seine Muttersprache. Voß allerdings beendete seine Übersetzung in sechs Bänden – nur ist sie völlig in Vergessenheit geraten. Heute weiß wohl kaum jemand noch darum. Bürger hingegen (einmal mehr) veröffentlichte zwar vollmundige Ankündigungen, ließ auch ein paar Müsterchen folgen – verlor dann das Interesse und die Arbeit blieb liegen.) Doch wie gesagt: Gegen Ende der 1780er hatte selbst der so empfindliche Voß diese Übersetzungs- Streitigkeiten beiseite gelegt.
Beruflich aber kam Bürger in diesem Jahrzehnt nicht vom Fleck. Er vertauschte zwar seine Amtmannschaft in Altengleichen mit einer in Wöllmarshausen. Aber er verdiente dort nur unwesentlich besser, und seine Vorgesetzten – die Häupter verschiedener Zweige der Familie derer von Uslar – mochten ihn zum Teil gar nicht. Dazu hatte er an seinem neuen Wirkungsort ein kleines Gut gepachtet – doch statt dass es zu seinem Lebensunterhalt ein paar Naturalien beitragen würde, wie er gehofft hatte, kostete es ihn, der kein Ökonom war, nur noch Geld. Bürger war somit schlechter daran als vorher. Verzweifelt sucht er nach einem besser bezahlten Amt. Er lässt seine Beziehungen spielen. Friedrich II. von Preußen schreibt er persönlich an (letztlich ohne Erfolg), und Goethe, der ihn vor kurzem noch im Schlepptau seines Herzogs Karl August besucht hatte, ebenso. Dieser lässt sich mit seiner Antwort ein halbes Jahr Zeit – nur, um Bürger abschlägigen Bescheid zu geben: In Sachsen-Weimar-Eisenach gibt es keine Stelle für einen wie ihn. Goethe rät ihm zu einem Dozentenamt an einer Universität – nur, um gleich hinzuzufügen, dass in Jena nichts Passendes zu finden wäre. Trotzdem: Noch in der Periode, die Band III abdeckt, sollte Bürger seine Pacht wieder aufgeben, seine Amtmannschaft ebenso, und nach Göttingen ziehen, wo er zunächst als Privatdozent, dann als außerordentlicher Professor ehrenhalber an der Universität unter anderem über Ästhetik las und über die gerade neue und von Bürger mit Enthusiasmus aufgenommene Philosophie Kants, die Kritik der reinen Vernunft. Gehalt allerdings erhielt er hierfür keines; er war auf die Bezahlung durch seine Studenten angewiesen.
Bürgers Privat- und Liebesleben veränderte sich in diesem Jahrzehnt auch nicht zum Besseren. 1784 starb seine erste Frau Dorothea und ein Jahr später konnte er endlich seine schon lange geliebte Molly, Dorotheas jüngere Schwester Auguste, heiraten. Zumindest sein privates Glück schien nun vollkommen – dann aber starb Auguste im Januar 1786 im Kindbett. Ihr Tod stürzte ihn, der schon vorher jahrelang an diffusen Krankheiten gelitten hatte (es gibt sogar ein Tagebuch der Gesundheit, das Bürger von 19. bis zum 26. Juli 1784 geführt hatte, und das im vorliegenden Buch ebenfalls enthalten ist), in eine Antriebslosigkeit, die ans heutige Krankheitsbild der Depression erinnert. Bürger stürzte in eine tiefe Krise. Erst das Ende der vom vorliegenden Band abgedeckten Periode findet ihn wieder munterer – und auf Freiersfüßen. Tatsächlich baggert er – wie wir heute sagen würden – verschiedene Frauen mündlich oder schriftlich an, und im Geheimen rühmt er sich auch diverser erotischer Abenteuer mit den Gattinnen oder Töchtern seiner Professorenkollegen.
Als Schriftsteller geht es Bürger auch nicht mehr glänzend – allerdings offenbar, ohne dass er es bemerkt hätte oder sich selber eingestanden. Zum Teil war dieses Absinken in der Gunst des Publikums sicher Bürgers eigene Schuld. Wir haben schon gesehen, dass er Werke bzw. Übersetzungen ankündigte, ohne sie je zu liefern. Neben Tausendundeiner Nacht ist da eine neue, in einem andern Versmaß als seine erste gehaltene Übersetzung der Ilias, die ihn eine Zeitlang beschäftigte. Er veröffentlichte ein paar Gesänge – und ließ dann auch dieses Werk liegen. Eine Übersetzung von Shakespeares Macbeth, die er für eine Aufführung nach Berlin versprochen hatte, vollendete er zwar – aber um zwei Jahre zu spät. Ende der 1780er machte er sich an eine zweite Shakespeare-Übersetzung – diesmal an den Sommernachtstraum und diesmal mit seinem jungen Aar, wie er seinen Meisterschüler August Wilhelm Schlegel nannte, der sich in dieser Zeit zu ihm gesellen würde. Doch auch das blieb liegen, und in dem, was Schlegel später veröffentlichte, hatte er, der sich unterdessen von Bürger ab- und Schiller zugewandt hatte, offenbar so ziemlich alle Spuren Bürger’scher Mitarbeit getilgt. (Der Herausgeber Ulrich Joost hat sich die Mühe gegeben, aus den vorhandenen Fragmenten den Bürger’schen Anteil herauszudestillieren und in einem Anhang zum Briefwechsel zu veröffentlichen.) Die Arbeit als Herausgeber des Göttinger Musenalmanachs brachte Bürger zwar etwas Geld, aber auch viel Arbeit und wenig Ruhm. Mit eigenen Werken sah es bei Bürger wo möglich noch schlechter aus als mit seinen Übersetzungen. Während nämlich die erste Auflage seiner Gedichte ein für damalig Zeiten großer Erfolg war und Bürger zu Beginn der 1780er auf dem Zenith seines Ruhms als Lyriker stand, harzte die Subskription für die zweite Auflage schon gewaltig. Sie dauerte rund drei Jahre und brachte doch nur die Hälfte der Interessenten auf, die sich auf die erste gemeldet hatten. Es ist faszinierend für uns heute, zu sehen, wie bereits Ende der 1780er zu spüren war, dass in Bälde der Lyriker Bürger, einst assoziiertes Mitglied des Göttinger Hains (dessen Mitglieder schon lange entweder tot waren (Hölty) oder sich bürgerlichen Berufen zugewandt hatten (Goeckingk) und der schon lange zu existieren aufgehört hatte), dann eine Art gemäßigter Stürmer und Dränger (ohne direkt zum Kreis um Goethe zu gehören) – dass der Lyriker Bürger also drauf und dran war, den Anschluss an die Entwicklung der deutschen Literatur verlieren und in kürzester Zeit zwischen dem sich bereits formiert habenden Block der Klassik einerseits, dem sich gerade bildenden der Frühromantik (auch Novalis gehört Ende der 1780er zu Bürgers Briefpartnern) andererseits, zerrieben werden sollte. Was heute von ihm bleibt, ist die frühe Ballade Le(o)nore (aber auch die mehr für die Germanistik als für die breite Masse) und sein Münchhausen. (Der wiederum ist zwar auch in der von diesem Band abgedeckten Phase entstanden, wir finden aber im gesamten Briefwechsel keine Spur davon. Ein Rätsel, das der Herausgeber Joost nur so zu erklären weiß, dass alle Involvierten – inklusive des notorisch geschwätzigen Verlegers Dieterich – für einmal zu schweigen wussten.)
À propos Dieterich. Die Bezeichnung mein Geldmännchen, die Bürger für ihn prägte, ist bekannt. Tatsächlich konnte sich der stets in Geldnöten steckende Amtmann immer darauf verlassen, dass – wenn alle Stricke rissen – Dieterich, manchmal zwar murrend, aber doch ein Darlehen gab. Dass Bürger über beide Ohren in Schulden steckte, lag auch daran, dass er seinen Lebensentwurf immer ins Große gestaltete. Er beklagte sich einmal darüber, dass er, bei einem Gehalt von 300 Talern jährlich, gesellschaftlich mit Leuten verkehren müsse, die über 1000 Taler oder mehr verfügten. Das war in seiner Zeit als Amtmann, aber auch der Dozent an der Universität Göttingen lebte auf großem Fuß, wie eine Rechnung zeigt, die sich erhalten hat, weil Bürger sie nie bezahlte und der Lieferant ihn verschiedene Male, auch über das Universitätsgericht, mahnte. Auf dieser Rechnung finden wir bedeutend mehr und bedeutend Teureres als nur Kartoffeln und Brot. Dass diese häufigen Mahnungen seinem Ruf in Göttingen schadeten, ist wohl klar. Und es war wohl auch wegen solcher Dinge, dass Bürger an der Universität ebenso wenig voran kam wie vorher als Amtmann.
Der vorliegende Band III des Briefwechsels (= Gottfried August Bürger: Briefwechsel. Herausgegeben von Ulrich Joost und Udo Wargenau. Band III. 1780 – 1789. Göttingen: Wallstein, 2021) ist, wie schon seine beiden Vorgänger exzellent editiert. Personen-, Wort- und Sacherklärungen im Anhang bringen viele wertvolle Informationen, ebenso die diversen Anhänge, von denen ich Bürgers Tagebuch der Gesundheit und die von Bürger übersetzten Fragmente des Sommernachtstraums schon erwähnt habe. Wir finden hier noch das Auktionsverzeichnis des Bürger’schen Hausrats 1784, als nämlich Bürger vom Land in die Stadt, nach Göttingen, zog. Im Gartenhaus seines Verlegers Dieterich, wo er unterkam, war bedeutend weniger Platz als noch auf dem Land, und Bürger musste einiges versteigern lassen. (Der Erlös der Versteigerung betrug, nebenbei gesagt, rund 300 Taler – also die Höhe seines Jahresgehalts als Amtmann. Wenn wir konservativ davon ausgehen, dass er beim Kauf all dieser Sachen rund drei Mal so viel bezahlt hatte, erhalten wir ein Bild davon, wie sehr Bürger in oeconomicis immer ins Große anrichtete.) Ein Verzeichnis der Vorlesungsankündigungen und eines der Subskribenten der zweiten Auflage der Gedichte vervollständigen die Materialien. (Kulturgeschichtliche Notiz am Rande: Unter den Subskribenten finden wir – neben Bürgers Freunden natürlich – unerwartet viele Frauen. Bürger verfügte da über ein wahres Netzwerk an weiblichen Fans. Soziologisch gesehen, waren seine Subskribenten in den meisten Fällen Adlige und vermögende Bürgerliche, ein paar Pfarrer, ein paar Offiziere. Auf der Liste finden wir auch den Namen des Vaters vom Philosophen Arthur Schopenhauer und den des Großvaters von Theodor Fontane.) Ein abschließendes, klug geschriebenes Nachwort des Herausgebers Ulrich Joost ordnet die Briefe dieses Jahrzehnts unter verschiedenen Gesichtspunkten in Bürgers Leben ein.
So wie diesen Band erwarte ich mir kritische Ausgaben von Werken oder Briefen. Hoffen wir, dass auch die Bände IV und V noch erscheinen können.