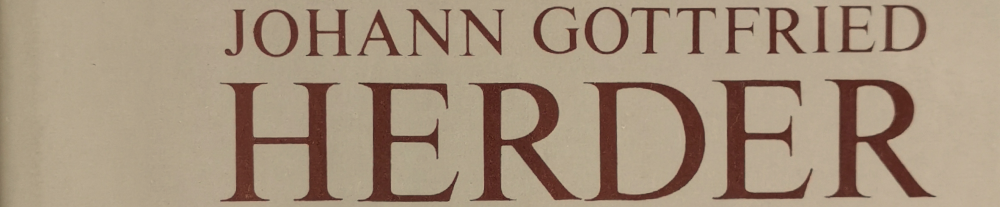Immer noch Bückeburg. Herders Situation wird je länger desto unerträglicher. Zwar hat er zwischen Band 2 und 3 der Briefausgabe in Darmstadt seine Caroline geheiratet und sie wohnt unterdessen bei ihm. Damit fallen zumindest die Ängstlichkeit weg, das Warten auf Briefe, die vielleicht verloren gegangen sind, vielleicht aber auch nie abgeschickt wurden. Auch kommen im Verlauf der durch Band 3 abgedeckten Periode zwei Söhne zur Welt, beide gesund. Die Mutter hat offenbar bei der Geburt keine schwerwiegenden Probleme gehabt (was zu jener Zeit nicht selbstverständlich war). Caroline und Gottfried leben im Übrigen ein sehr symbiontisches Leben, was sich auch in den Briefen zeigt. Amtliche Dokumente ausgenommen, ist es oft Caroline, die in Herders Auftrag (unter seinem Diktat?) schreibt, oder dann unterschreibt sie Herders Briefe ebenfalls. Manchmal fügt sie sogar einen oder zwei Abschnitte hinzu. Im Anhang finden wir auch Briefe, die Caroline offenbar aus eigenem Antrieb, aber sozusagen im Namen der Familie, geschrieben hat. Privat läuft also alles bestens.
Beruflich sieht es ein wenig anders aus. Zwar wird er in Band 3 zum Superintendenten der Grafschaft Schaumburg-Lippe ernannt. Das bedeutet aber nur mehr Arbeit, denn weder werden ihm andere Aufgaben abgenommen, noch wird sein Gehalt erhöht. Erschwerend kommt hinzu, dass sich sein Landesherr, Graf Wilhelm Friedrich Ernst zu Schaumburg-Lippe, in bester absolutistischer Manier in Herders Arbeit mischt, bis hinein ins Tagesgeschäft, ob es nun um Ernennungen von Pfarrern geht oder den anzuwendenden Katechismus. Dass er dann auch schon mal seine eigenen Anordnungen von letztem Jahr vergisst, macht Herders Aufgabe nicht einfacher. Dann stirbt auch noch Graf Wilhelms Gattin Maria, mit der sich Herder so gut verstanden hat. (Einerseits ist Herders Offenheit irgendwie erfrischend, andererseits ist seine Lage natürlich erschreckend, wenn er einem gewissen Pastor Grupen, der sich für eine frei werdende Stelle im Fürstentum interessiert und Herder um Unterstützung bittet, ganz ehrlich schreibt, dass seine (Herders) Unterstützung höchstens kontraproduktiv wirken würde – und das vom obersten Geistlichen des Landes!)
Mit einem Satz: Herder will von Schaumburg-Lippe weg.
Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Er kann nur unter der Hand suchen, wenn er es sich mit Graf Wilhelm nicht völlig verderben will. Doch dann kommt die Chance: Er wird ohne eigenes Zutun von Hannover aus zum Professor der Theologie in Göttingen ernannt. Schon bestellt er bei Boie einen Wagen, weil er in Bückeburg nichts Gescheites für den Umzug findet. Dann die Enttäuschung: Seine Gegner haben in London bei George III interveniert. Der ist in Personalunion auch Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg (vulgo: Kurfürstentum Hannover). Er verfügt, dass Herder vorgängig zu einer Amtseinsetzung in einem Gremium vor seinen eventuellen zukünftigen Amtskollegen seine Rechtgläubigkeit unter Beweis zu stellen habe. (Seine Gegner haben gewusst, wo ansetzen: George ist tief gläubig und betet stundenlang …) Herder nimmt das zu Recht als Affront wahr und protestiert in Göttingen (u.a. bei seinem Freund Heyne): Sich vor seinen zukünftigen Kollegen einer solchen Prüfung unterziehen zu müssen, würde das Verhältnis unter den Kollegen von Beginn weg trüben, ist sein Argument. Nach langem Hin und Her – denn Herders Bedürfnis, von Bückeburg wegzukommen, wird immer größer – einigt man sich darauf, dass es sich um eine Disputation zur Erlangung der Doktorwürde handeln solle, denn die war für eine Professur unumgänglich. Zähneknirschend stimmt Herder zu.
Dann – wenn man nach dem Briefwechsel geht – abermals aus heiterem Himmel trifft aus Weimar die Ernennung zum Superintendenten des dortigen Herzogtums ein. Goethe (und der bei diesem Geschäft oft in Vergessenheit geratene Wieland) haben sich beim jungen Carl August für Herder eingesetzt. Es handelt sich hier nicht nur um einen Freundschaftsdienst Goethes (wie weit er über Herders Situation und dessen Gefühlslage informiert war, geht aus dem vorliegenden Buch nicht hervor – Goethe hat alle erhaltenen Briefe aus dieser Zeit verbrannt). Denn natürlich handeln weder er noch Wieland, der andere im Bunde, uneigennützig. Einen liberalen obersten Geistlichen in ihrem kleinen Herzogtum zu haben, ist auch für sie persönlich wichtig. Weder Wieland, dessen Schriften damals als äußerst freizügig gelten, noch Goethe, dessen bisherige Werke auch nicht ganz koscher sind, bei dem es zu jener Zeit aber mehr der aktuelle Lebenswandel ist, haben Lust auf Auseinandersetzungen mit einem konservativen, rigoros eingreifenden Kirchenmann. Herder ist sich dieser Motive seiner Freunde sicherlich bewusst und weiß genau, wem er die Ernennung zu verdanken hat, weiß also auch um Wielands Intervention: Er sendet Merck (mit dem er sich notdürftig versöhnt hat) ein paar seiner Gedichte zur Veröffentlichung im Teutschen Merkur Wielands. Allerdings sollen sie anonym erscheinen, denn ein dichtender Superintendent ist wohl Herder selber verdächtig.
Daneben finden wir, dass sich in der von Band 3 abgedeckten Epoche das Verhältnis zu Nicolai immer mehr lockert. Herder schreibt kaum noch Rezensionen für dessen Zeitschrift. An Lavaters Physiognomik nimmt er dagegen regen Anteil und leistet auch Beihilfe. Last but not least taucht J. M. R. Lenz auf und nimmt nun in Herders Gedankenwelt einen ähnlichen Platz ein wie vormals Goethe.
Der Band schließt mit den Umzugsvorbereitungen der Herder’schen Familie. Zunächst muss der Zweitgeborene noch etwas älter werden, um die lange Reise von Bückeburg nach Weimar ohne Probleme überstehen zu können. Aber das Kündigungsschreiben ist schon verschickt. So fällt der Vorhang von Band 3 unmittelbar vor der Zeit Herders in Weimar.
Johann Gottfried Herder: Briefe. Dritter Band. Mai 1773-September 1776. 5300 Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger DDR, ursprünglich 1978, vor mir liegt ein fotomechanischer Nachdruck, o.J.