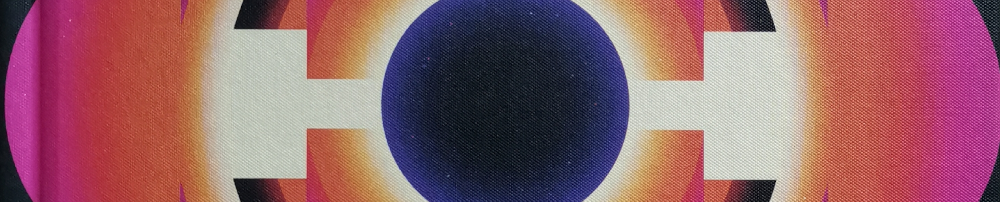Neil deGrasse Tyson ist für den englischen Sprachraum (insbesondere die USA), was Harald Lesch für den deutschen ist: der physikalische und astronomische Erklärbär schlechthin – eigener YouTube-Kanal inklusive. Lange Jahre hatte er auch eine Kolumne im Magazin Natural History. Aus diesen Aufsätzen wurden auch die einzelnen Essays ausgesucht, die das vorliegende Buch bilden – sein erster Bestseller übrigens. 2007 erschien es zum ersten Mal; vor mir liegt eine Ausgabe von diesem Jahr (2024) bei der Folio Society in London. Sie scheint, mit Ausnahme eines kleinen zusätzlichen Satzes im Vorwort, unverändert zu sein. Auf Deutsch gibt es das Buch meines Wissens nicht. Wörtlich übersetzt müsste der Titel „Tod durch [ein] Schwarzes Loch“ lauten.
Tysons Aufsätze wurden in diesem Buch thematisch in sieben Großkapitel (im Englischen: Sections) eingeteilt. Das braucht uns nicht weiter zu interessieren, weil der Inhalt der jeweiligen Aufsätze des öfteren nur am Rand mit dem der Section zu tun hat, der es beigeordnet wurde. Die Aufsätze wurden ja ursprünglich unabhängig von einander und nicht in der vorliegenden Reihenfolge abgefasst. Das macht sich leider auch in manchen inhaltlichen Wiederholungen bemerkbar.
Wie ich überhaupt, um es kurz zu machen, ein bisschen enttäuscht bin. Tyson spricht zwar in großer Dankbarkeit vom Evolutionsbiologen Stephen Jay Gould, der eine Zeitlang gleichzeitig mit ihm im Magazin Natural History veröffentlicht hatte und von dem er viel in Bezug auf das Schreiben von Aufsätzen für ein Laien-Publikum gelernt haben will. Mag sein, es liegt daran, dass ich über Evolutionsbiologie noch weniger weiß als über Astrophysik. Aber meines Empfindens hat Gould seine Aufsätze zur Evolutionsbiologie bedeutend interessanter gestaltet als Tyson die seinen über das Universum. Ein wenig mag es auch daran liegen, dass Tyson Ausflüge in die Mathematik scheut wie der Teufel das Weihwasser. Inhaltlich sind seine Darstellungen, was ich einschätzen kann, korrekt; ich weiß allerdings nun nicht, wie weit seine Präsentation von Schwarzen Löchern, die ja aus dem Jahr 2007 und früher stammt, im Jahr 2024 noch ganz korrekt ist, aber das Wesentliche hat meiner Meinung nach nicht geändert. Aber: Tyson bleibt bei seinen Erklärungen für meinen Geschmack zu sehr an der Oberfläche. Seine Scheu vor mathematischen Formeln macht die Erklärung der Relativitätstheorie (um ein Beispiel zu nehmen) unklar. (Da würde ich allen raten, direkt zur Quelle zu gehen und die besser verständlichen Ausführungen Albert Einsteins in dem schmalen Band Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie direkt zu lesen. Ja, Einstein verwendet Mathematik. Genau deshalb ist sein Text aber auch klarer und präziser.) Ähnlich steht es um die auch von Tyson erwähnte Tatsache, dass Relativitätstheorie und Quantenphysik in vieler Hinsicht zu einander in Widerspruch stehen. Wie genau, erfahren wir in diesem Buch nicht. Tyson löst das Problem auf, indem er dem Publikum einfach mitteilt, dass die beiden Systeme nicht dieselben Phänomene beschreiben würden. Tiefer geht er nicht darauf ein. Er erwähnt zwar noch die Stringtheorie als den Versuch, die beiden rivalisierenden Theorien miteinander zu vereinen. Was die Stringtheorie genau ist, erfahren wir aber aus seinem Text nicht. (Nun ja: Die Stringtheorie kann nicht beschrieben werden, ohne zumindest ansatzweise Mathematik einzuführen, auch wenn die genauen Berechnungen nur ein paar hochspezialisierten Mathematiker:innen zugänglich sind.) Dafür wird immer wieder auf Science Fiction-Filme Bezug genommen, speziell auch auf die TV-Serie Star Trek. Zusammen mit den oft etwas flach daherkommenden Witzen, die Tyson einstreut, lässt das wohl ungefähr erahnen, welche Art Publikum er anzusprechen sucht. Ich gehöre da jedenfalls nicht so ganz dazu.
Nicht zuletzt zeigt sich Tyson immer wieder, aber vor allem am Schluss des Buchs, auch sehr USA-konzentriert, so wenn er bedauert, dass der US-amerikanische Kongress die Finanzierung eines US-amerikanischen Teilchenbeschleunigers gestoppt hat und die US-amerikanischen Forscher:innen nun auf ausländische Modelle ausweichen müssen. Oder gar, wenn er versucht, seinen Glauben bzw. Nicht-Glauben darzustellen – natürlich so, dass er den gläubigen Teil seines US-amerikanischen Publikums nicht verscheucht. Das Resultat ist auch hier absolute Unklarheit.
Fazit: Das Buch ist allenfalls als Einstieg in die Materie geeignet, für einen jungen Menschen von 10 oder 12 Jahren, der sich gerade fürs Thema Astrophysik zu interessieren beginnt. Oder anders, bösartig, formuliert: Was Tyson vermittelt, sind im Grunde genommen Wissensbrocken, die, wer so etwas besucht, an Cocktail-Partys im Small Talk angebracht werden können, und mit denen in diesem Umfeld sicher auch geglänzt werden kann.
PS. Für alle Freunde und Freundinnen eines Planeten Pluto: Neil deGrasse Tyson war eine der führenden Stimmen, die sich dafür stark machten, dass Pluto der Status des Planeten aberkannt wurde.