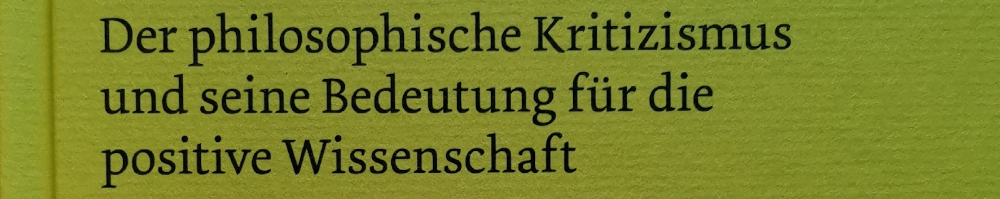Der Philosophieprofessor Alois Riehl, der in Innsbruck seinen Doktortitel erlangte, in Graz habilitierte und über Umwege schließlich in Berlin zum Nachfolger von Wilhelm Dilthey gewählt wurde, stellt einen wichtigen Pfeiler dar in der Reihe der Philosophen, die Kants Philosophie am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts weiterzuführen und mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft in Übereinstimmung zu halten suchten. Diese Philosophen, die man gemeinhin unter dem Oberbegriff des Neukantianismus zusammen fasst, waren davon überzeugt, dass vor allem Kants Erkenntnistheorie mit den naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen zu Kants wie zu ihrer Zeit durchaus in Übereinstimmung stand. Sie waren mit der Ansicht, dass sich die Philosophie nicht von den Wissenschaften entfernen sollte, demzufolge ein wichtiger (wenn auch – zumindest zu meiner Zeit – meist vergessener) Teil jenes philosophischen Klimas, aus dem und in dem der Wiener Kreis und der logische Positivismus stammten und wurzelten.
Genauer gesagt war Riehl Teil der Kritizismus genannten Strömung, die sich in Forschung und Lehre vor allem mit der Kritik der reinen Vernunft beschäftigten, wie es der Name ihrer Strömung ja schon andeutet. Zentraler Ausführungen seiner kritizistischen Lehre finden sich in der philosophiegeschichtlichen Untersuchung Der philosophische Kritizismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft, die ab 1876 in drei Bänden zu erscheinen begann. Diese drei Bände sollen nun beim Verlag Felix Meiner wieder zugänglich gemacht werden, aktuell existiert aber nur der vor mir liegende erste Band.
Der stellt den im engeren Sinne philosophiegeschichtlichen Teil seiner Abhandlung dar. Riehl untersucht hier den Einfluss verschiedener Autoren auf die Entwicklung Immanuel Kants in Richtung auf die Kritik der reinen Vernunft bzw. deren Inhalt und Darstellung. Im Speziellen wird Lockes Einfluss dargestellt, dann natürlich der David Humes, aber auch Wolff, Lambert und Tetens sind prominent vertreten. Unter den ihn, Riehl, selber beeinflussenden Autoren sind vor allem Wundt zu nennen, Herbart und Dühring*). Vom logischen Positivismus unterscheidet Riehl die Ablehnung jeder Form von psychologischer Herleitung der Kategorien der Erkenntnis, vom Skeptizismus der Gedanke, dass Kant zwar kritisch vorging, aber nicht eben gerade kein skeptischer Alleszermalmer war. (Auch wenn er zugibt, dass es Kant mit seinen Kategorien dann doch ein wenig übertrieben hat.)
Folgerichtig kommt Riehl zum Resultat, dass Locke und Hume im Grunde genommen noch psychologisch (und damit vor-philosophisch) argumentierten und erst Kant rein erkenntniskritisch und damit theoretisch-philosophisch. Auch kommt er zum Schluss, dass Kant – anders als seine vermeintlichen Nachfolger Fichte, Schelling und Schopenhauer dachten (Hegel wird bezeichnenderweise gar nicht erst genannt) – gerade eben kein Idealist war sondern ein Realist. Das Ding an sich, das zu Erkennende und doch nicht Erkennbare, ist ebenso real wie die Gegenstände jeder Art von Naturwissenschaft, deren Eigenschaften von der Forschung auch nicht bis zum Grund erschöpft werden können. Im Übrigen erhält der Text dort, wo er Darwin und die Evolutionstheorie streift, schon erste Färbungen einer evolutionären Erkenntnistheorie, wie sie im 21. Jahrhundert entwickelt wurde. Auch dieser Spur könnte man wohl nachgehen.
Das Fazit für den ersten Band formuliert Riehl wie folgt:
Die Methode Kants besteht in der durchgeführten Trennung der Form vom Inhalt des Erkennens. […] Allein die reine Logik schafft noch keine Erkenntnis. Nun entdeckte Kant zu den logischen Formelementen ursprüngliche Bestandteile der sinnlichen Erkenntnis, die Formen des Anschauens. Aus der Verbindung dieser Formen mit den logischen Elementen entstand eine formale Erkenntnis zum Unterschied vom formalen Denken. Und diese Erkenntnis bezog sich a priori nicht bloß auf die Form der Wissenschaft, sondern auf die Form der Erfahrung, weil ihre Grundlagen zugleich die Formen der Auffassung der Dinge sind. Dadurch besitzt die Erkenntnis a priori notwendig gegenständliche Bedeutung. Die Kritik der reinen Erkenntnis hat den Beweis der Wahrheit der Erfahrung angetreten und durchgeführt. [S. 474, Kursivschreibung im Original]
(Dass reine Logik keine Erkenntnis schafft, hat sich der frühe Wittgenstein im Tractatus logico-philosophicus mühsam selber erarbeitet. Aber statt zum zweiten voran zu schreiten – ich glaube nicht, dass er Riehl gekannt hat – hob er zum Schluss des Tractatus in mystische Gefilde ab. Die angelsächsische Philosophie zu Wittgensteins Zeit und bis heute, zwar damals mit dem Hegelianismus kämpfend, aber vom Neukantianismus oder gar Kant ziemlich unbeleckt (und auch Hume gilt dort bis heute als Historiker!), nahm sowieso nur noch den logischen Teil des Tractatus zur Kenntnis, das von Wittgenstein nicht ohne Absicht und vielleicht gar mit Blick auf den Neukantianismus (wenn auch nicht Riehl) hinzu gesetzte -philosophicus völlig missachtend.)
Anmerkung:
*) Eugen Dühring, der – bevor er in esoterisch-abstruse Pseudowissenschaft abglitt (die keineswegs verharmlost werden sollte: er war einer der ersten, der den bisher theologisch motivierten Antisemitismus auf eine, wie man sie nannte ‚rassentheoretische‘ Grundlage stellte und damit zu jenen gehört, die erst den Nationalsozialismus und dessen Streben nach Vernichtung der minderwertigen Rassen, darunter der Juden, möglich machte; und ja: Engels bekanntes Werk, der Anti-Dühring, meint diesen Dühring hier) – ein Dühring also, der zum Zeitpunkt als Riehl sein Buch verfasste, ein recht bekannter und mindestsens wohl passabler Philosoph gewesen war.
Alois Riehl: Der philosophische Kritizismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft. Erster Band: Geschichte und Methode des philosophischen Kritizismus. Mit einer Einleitung, Anmerkungen und Register herausgegeben von Rudolf Meer, unter Mitarbeit von Josef Hlade, Julia Meer und Mischa von Perger. Hamburg: Felix Meiner, 2023. (= Philosophische Bibliothek 766)