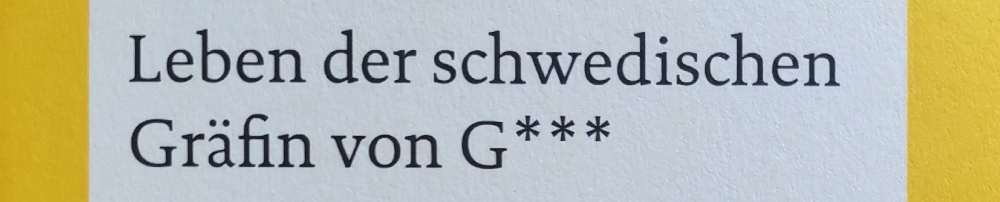Romane wie diesen kann man heutzutage gar nicht mehr schreiben. Also … schreiben kann man so etwas natürlich schon noch, aber man wird kein Publikum mehr finden. Die dahinter stehende Poetologie und Ethik stammte aus England, wo sie ungefähr fünfzig Jahre vor Gellert schon Mode gewesen war. Die deutsche Literatur war hier einmal mehr die Nachzüglerin. Und schon knappe dreißig Jahre nach der Veröffentlichung dieses Romans von Gellert sollte der Sturm und Drang in Deutschland nur noch Hohn und Spott über Gellerts Art des Schreibens ausgießen – zumindest Teile des Sturm und Drang. Publikum wie Autor:innen sollten sich in der Folge davon abwenden, und das ist bis heute so geblieben.
Der Reihe nach: Der Roman Leben der schwedischen Gräfin *** erschien in zwei Teilen 1747/48. Großes Vorbild Gellerts war der englische Schriftsteller Samuel Richardson, vor allem mit seinen zwei Romanen Pamela und Clarissa. (Ich habe beide vor Jahren einmal gelesen und beschlossen, dass ich mir das nie mehr antun werde.)
Die hinter dieser Literatur stehende Ethik und Poetologie kennt vornehmlich zwei Wurzeln: Erstens steht dahinter eine fromm-christliche Einstellung zum Leben, meist aus pietistischen Quellen gespiesen. Andererseits finden wir aber auch eine aufklärerisch-rationalistische Haltung in dieser Form der Literatur. Übergreifend spricht die Literaturgeschichte – zumindest im deutschen Sprachraum – von dieser Literaturepoche als von der Empfindsamkeit.
Nur schon ein Blick auf Gellerts Vornamen, vor allem den zweiten, genügt, um eine streng christliche Herkunft des Autors feststellen zu können. Tatsächlich stammt er aus einer Pastorenfamilie. Er sollte später Professor der Moralphilosophie werden und lebte von 1715 bis 1769. In seiner Rolle als Professor der Moralphilosophie war er so etwas wie ein Praeceptor Germaniae, eine weit herum anerkannte Gestalt, der auch Goethe noch huldigte. Zumindest teilweise.
Im vorliegenden Roman will Gellert die Seelenstärke und -ruhe einer zwar aufgeklärten, aber ihr Schicksal dennoch immer noch in Gottes Hände legenden Gesellschaft aufzeigen. Das klingt altmodisch-verzopft und ist tatsächlich der Hauptgrund, warum ich behaupte, dass heute so ein Roman nicht mehr geschrieben werden könnte. Der zweite Grund ist, dass Gellert, um diese Seelenstärke zu zeigen, seinen Protagonist:innen unmöglichste Verwicklungen zumutet. Geografisch spannt sich die Geschichte vom damals schwedischen Lettland über das eigentliche Schweden nach Moskau und Sibirien einerseits, nach den Niederlanden andererseits. Die Gräfin und ihr heiß geliebter Mann werden nämlich durch Krieg von einander getrennt. Sie kommen nach vielen Schicksalsschlägen wieder zusammen und der Schluss des Romans spielt sich dann in London ab. Noch wilder und verwickelter ist, was ihnen unterwegs zustößt. Ein übel wollender Mitrivale macht, von der jungen Gräfin abgewiesen, seinen Einfluss am schwedischen Hof geltend, um den frisch gebackenen Ehemann in ein schlechtes Licht zu stellen. Und das ist nur der Anfang. Tatsächlich gießt Gellert über die Familie seiner Protagonistin so ziemlich alle Übel aus, die sich finden lassen: Bigamie, Inzest, Mord, Selbstmord, mehrfacher Verlust des Vermögens … you name it, Gellert got it. Gellert war sich dabei ganz und gar bewusst, dass er übertrieb. Das war Teil seines ethisch-didaktischen Programms und wurde damals von großen Teilen des lesenden Publikums dankbar aufgenommen und auch so begriffen. Schon der Sturm und Drang allerdings sollte das nicht mehr verstehen (wollen).
Leben der schwedischen Gräfin *** ist zwar kein eigentlicher Briefroman wie zum Beispiel die oben erwähnten Romane von Richardson, aber an einigen Stellen greift Gellert doch auf Briefe zurück, um gewissen Ereignisse zu erklären bzw. zu schildern, so dass ich versucht bin, diesen Roman hier einen Halb-Briefroman zu nennen.
Und ja: Es finden sich auch durchaus ‚progressive‘ Züge in diesem Roman. Da ist zum Beispiel, neu für die damalige Zeit, dass Gellert als erster seine Geschichte von einer Ich-Erzählerin berichten lässt. Mehr emanzipatorische Spitzen sollte allerdings ein Vierteljahrhundert später Sophie von La Roche mit ihrem (ebenfalls noch der Empfindsamkeit zugerechneten) Roman Geschichte des Fräuleins von Sternheim unterbringen. (Die Verwandtschaft der beiden Romane wurde von Sophie von La Roche nur schon dadurch bekräftigt, dass sie Gellerts Titel imitierte.) Aber es war Gellert, der den emanzipatorischen Damm durchbrach. Ebenfalls finden wir eine – allerdings sehr zart angedeutete – Liebesgeschichte zwischen dem Grafen und einer jungen Kosaken-Frau. (Gellerts Personal besteht keineswegs aus Heiligen!) Kosaken galten damals als allerhöchstens halb zivilisierte Menschen, und so hat hier der literarische Topos des ‚edlen Wilden‘ schon sehr früh in der deutschen Literatur Einzug gehalten. Nehmen wir noch hinzu, dass unter den Menschen, die dem Grafen in Sibirien beistehen, ein paar jüdische Kaufleute sind, deren internationales kaufmännisches Beziehungsgeflecht Gellert offenbar kannte. In seiner Darstellung der Juden stellte sich Gellert also gegen den gängigen Antisemitismus der Zeit. So finden wir denn sowohl konservative wie progressive Züge in diesem Werk, weshalb es zumindest den literatur- und /oder geistesgeschichtlich Interessierten immer noch zu empfehlen ist.
Der Herausgeber der vor mir liegenden Ausgabe (s.u.) hat verdankenswerter Weise in einem Anhang auch einige Pressestimmen (wie wir heute sagen würden), also Rezensionen früherer Zeiten, abgedruckt. Darunter sind:
- Hamann (1750): Seine [Gellerts – P.H.] Werke sind der Tugend viel einträglicher als unzählige Schriften, die in einer hohen Schreibart eine gemeine Sittenlehre enthalten.
- Lessing (1753 – also noch in seiner eigenen empfindsamen Phase): Die Schwedische Gräfin schien einen neuen und bessern Zeitpunct derselben [i.e. der deutschen Romankultur, wie aus den vorhergehenden Sätzen hervorgeht – P.H.] anzufangen, allein zum Unglücke hat sich die deutsche Nacheiferung hierinnen am allersaumseligsten finden lassen.
- Albrecht von Haller, Aufklärer und Naturwissenschaftler, bemerkt dann 1775 schon: Freylich hat Hr. G. hier in eine Familie eine Menge schrecklicher Begebenheiten zusammengehäuft, die vermutlich seit dem Geschlechte des Lajus [Laios, Sohn des Labdakos, Vater des Ödipus – P.H.] nicht zusammen eingetroffen. Nur ein paar Jahrzehnte, und schon wird das Unwahrscheinliche des Plots bereits so wichtig wie die Botschaft des Autors …
- Merck hält 1778 in Wielands Teutschem Merkur fest, dass man in der Literatur unterdessen von Gellerts in der Gräfin von G*** zum Ausdruck gebrachten poetischen Prinzip abgekommen sein, denn eigentlich gelte nun, […] nichts sey so elend und fade als eine Reihe wundersamer Begebenheiten und Avanturen. Merck, selber einmal mit pietistisch-empfindsamen Kreisen verbandelt, muss zu seinem Bedauern festhalten, dass aus diesem empfindsamen Prinzip denn alle die neuern Episch-dramatischen Werke [entstanden sind], wo unter 10 nicht eins an die Güte der Schwedischen Gräfin reicht.
- 100 Jahre später (1851) schreibt dann Eichendorff in seiner passend Der deutsche Roman des achtzehnten Jahrhunderts in seinem Verhältniß zum Christentum betitelten katholischen Literaturgeschichte: Man sieht also selbst beim frommen Gellert die See innerlich hohl gehen, und die Wogen sind nur durch das obenauf schwimmende Oel der Moral noch beschwichtigt und niedergehalten.
So schnell wurde man unduldsam und vergaß, warum Gellert so und nicht anders geschrieben hatte …
Gelesen habe ich den Roman in folgender Ausgabe:
Christian Fürchtegott Gellert: Leben der schwedischen Gräfin G***. Herausgegeben von Alexander Košenina. Ditzingen: Reclam, 2019. (= RUB 18610). Enthält, auf dem Titelblatt nicht angegeben, neben dem Roman einen Anhang mit einem philologischen Text (Zu dieser Ausgabe); Rezensionen, Wirkungsdokumente und Selbstkommentare; Anmerkungen; Literaturhinweise und last but not least einem sehr informatives Nachwort des Herausgebers.