Curiosa
In diese Abteilung meiner Bibliothek gehört vorliegendes Buch. Schon als Student las ich sehr gerne Bücher, die die Entstehung von irgendetwas aus irgendetwas anderem mehr oder weniger wissenschaftlich herleiten – sei es der Welt, sei es eines bestimmten Aspekts dieser Welt. Das können systematische Geschichtsentwürfe sein oder sonstige Versuche, Phänomene menschlichen Daseins zu erklären. Dabei bin ich kein Historiker und habe mir keine geschichtswissenschaftlichen Techniken angeeignet. Es ist bei mir im Grunde genommen das Interesse des Kindes an den Bildern, die ein Kaleidoskop zu erzeugen vermag.
Lublinskis Entstehung des Christentums aus der antiken Kultur habe ich tatsächlich schon als Student gekauft – zu einer Zeit also, als Antiquariate noch Kataloge auf Papier tippten, vervielfältigten und an potentielle Interessenten verschickten. Den Namen „Samuel Lublinski“ kannte ich dabei nicht, bestellte das Buch aber trotzdem, denn der Titel versprach einen weiteren Welterklärungsversuch. Schon als ich es kaufte, war das Buch alt – vor mir liegt ein Exemplar des 1. und 2. Tausend / verlegt bei Eugen Diederichs in Jena / 1910. Stockfleckig, die Seiten von Hand aufgeschnitten, der papierene Buchrücken beginnt abzublättern – das Ganze war wohl in dieser Form nur zur Auslieferung gedacht, und der jeweilige Besitzer sollte das Buch auf eigene Kosten und nach eigenem Geschmack binden. Meiner hat es nicht getan, dafür – vor allem zu Beginn des Textes und dann wieder am Schluss – fleißig mit Bleistift Unterstreichungen hinterlassen.
Lublinski, so viel habe ich seit meinem Kauf herausgefunden, kam 1868 zur Welt und gilt als Pionier der Literatursoziologie. Er war jüdischer Herkunft, liebäugelte eine Zeitlang mit dem Zionismus, um dann herauszufinden, dass er sich vorwiegend als ‚Deutscher‘ fühlte – in nuce die Befindlichkeit so vieler Juden im Deutschen Reich, die rund ein Vierteljahrhundert nach Lublinskis Tod (er starb noch im Erscheinungsjahr der Entstehung des Christentums aus der antiken Kultur) so viele in einen tödlichen Zwiespalt stürzen sollte. Doch das ist hier nicht das Thema. Genau so wenig wie der Umstand, dass Lublinski 1904 als einer der ersten Literaturkritiker Thomas Manns Die Buddenbrooks öffentlich auslobte. Mann vergaß es ihm nicht. Theodor Lessing, der Lublinski wegen seines wenig ansprechenden Äußeren und seines Judentums in einer schlecht gelungenen Satire lächerlich zu machen versuchte, wurde von Thomas Mann deswegen scharf in die Schranken gewiesen – einer der großen Literaturskandale des Jahres 1910.
Liebe Leserin, lieber Leser, du merkst, ich halte mich bei Paraphernalia und Kleinigkeiten auf – was jedes Mal bedeutet, dass ich nicht so recht weiß, was ich zum Text schreiben könnte. Tatsächlich ist vieles, von dem, das Lublinski hier beibringt, nicht neu. Heute ganz sicher nicht neu, wahrscheinlich schon 1910 nicht neu. Lublinski oszilliert zwischen Sach- und Fachbuch, steht aber dem Sachbuch bedeutend näher. Wir finden die typischen Schwächen eines Buchs, das ein größeres Publikum ansprechen sollte: kein Literaturverzeichnis, keine sauberen Quellennachweise – viel Interpolation des Autors, die nicht als solche gekennzeichnet ist.
Nach einem Zitat von Ludwig Uhland zur historischen Einsicht als Motto, das wohl obige Schwächen entschuldigen soll, geht es in einem Vorwort ganz kurz zur ökonomischen Basis des Römischen Reichs nach Augustus (die Lublinski, völlig ahistorisch als auf Sklaverei beruhenden Kapitalismus bezeichnet – er wird später auch den Begriff ‚Romantik‘ völlig ahistorisch verwenden), von da zu einem Prolog – der einen Ausflug in die Philosophie der Antike macht. Die Vorsokratiker schildert er kurz, aber positiv – was vor allem daran liegt, dass er bei ihnen reine Beobachtung findet ohne metaphyisches Deduzieren. Das kommt für ihn erst mit Sokrates, Platon und Aristoteles in die Philosophie. Platon mit seinem Reich der Ideen, die nicht nur unabhängig von menschlichem Erkennen existieren, sondern als Vor- und Urbilder aller irdischen Existenz von dinglichen wie von konzeptualen Phänomenen aufzufassen sind, ist für Lublinski dann der Ahnherr aller kommenden Religionen, die einen oder mehrere Götter als Urbilder irdischen Wesens postulieren. (Immanuel Kant wird übrigens von Lublinski bei dieser Kritik am Idealismus ausdrücklich ausgenommen. Ja, sein Konzept des ‚Dings an sich‘ wird sogar als höchster Fortschritt in der Erkenntnistheorie gelobt, und die zeitgenössischen Naturwissenschaftler dafür kritisiert, dass sie nach wie vor reden und schreiben, wie wenn die Dinge, mit denen sie sich beschäftigten, eine absolute Wirklichkeit besäßen.)
Von dieser Ideenwelt geht Lublinski dann über zum Mythos. Daran interessieren ihn verschiedene Phänomene: die Erschaffung der Welt oder den sich abzeichnenden Dualismus zwischen guten und bösen Göttern (Dämonen), der dazu führt, dass sich ein guter Gott opfern muss, um die Welt zu retten, dann aber wieder aufersteht und – weil es sich hier meist um einen Sohn des obersten Gottes handelt – eingeht ins Himmelreich, wo er zur Rechten seines Vater zu sitzen kommt. Er findet, parallel zum Dualismus von Gut und Böse, die Abgrenzung eines obersten, guten, sich nicht mit der Materie befleckenden Gott von einem untergeordneten Schöpfergott (der dann eben auch bösartig sein kann). Diese Phänomene werden in Griechenland nachgewiesn, in persischen Religionen (vor allem dem Zoroastrismus) und auch im Judentum, wo Lublinski spätestens in römischer Zeit eine Dichotomie vorfindet zwischen Jaweh, ursprünglich dem lokalen Stammesgott, allenfalls Schöpfer der Welt, und dem über ihm und allem stehenden Adonai, dem HErrn (um, anders übrigens als Lublinski, die alte Schreibweise zu verwenden). Dieser HErr ist dabei Vater und Sohn gleichzeitig. (Warum der Autor allerdings Zarathustra und seine Religion des öfteren bemüht, Mani und dessen Religion aber, die das Paradigma eines kosmologischen Dualismus darstellen, mit Schweigen übergeht, kann ich nicht sagen.)
So weit, so gut, und wir kennen ähnliche Deduktionen auch aus wissenschaftlich ernster zu nehmenden Schriften wie z.B. Roskoffs Geschichte des Teufels (die eine der Quellen Lublinskis zu sein ich im Verdacht habe). Aber unser Autor will mehr als nachweisen, dass vieles der christlichen Mythologie so oder ähnlich schon in älteren Mythen zu finden ist, also wahrscheinlich auch von dort entlehnt wurde. Er gehörte zu jenen nach der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Schwange stehenden Autoren, die eine historische Existenz Jesu gänzlich abstritten. Vorliegendes Buch präsentiert hiezu nur die Präliminarien; ausgeführt wurde dieser Teil dann in dem im selben Jahr wie Die Entstehung des Christentums aus der antiken Kultur erschienenen Buch Das werdende Dogma vom Leben Jesu. In der Entstehung begnügt sich Lublinski damit, eine Spaltung des Judentums in der Zeit vor der Zerstörung Jerusalems zu demonstrieren: Hie die das Gesetz als einzige und oberste Instanz des jüdischen Seins akzeptierenden Pharisäer, da Mysterien huldigende Juden und Proselyten. Letztere Sekten produzierten immer mal wieder in ihren Reihen einen Messias – einen, der die Juden aus den Ketten der Herrschaft – je nachdem der Welt oder auch nur Roms – befreien sollte. Diese Messiasse führten ihre Anhänger – und mit sich auch die übrigen Juden – immer mal wieder in größere oder kleinere Aufstände gegen das Römische Reich. So lange Jerusalem noch existierte – so Lublinski – konnten die beiden Strömungen irgendwie koexistieren. Nachdem aber die Römer unter Titus beim Niederschlagen des letzten großen Aufstands im Jahre 69 Jerusalem und den Tempel zerstörten, war der physisch-geografische Identifikationsort des Judentums verschwunden. Die Pharisäer, aus denen die späteren Rabbis hervorgingen, reagierten darauf, indem sie das Gesetz als Identifikationspunkt immer stärker in den Mittelpunkt stellten. Blinder Gehorsam ihm gegenüber, Befolgung aller, auch rein äußerlicher Vorschriften, wie z.B. der Beschneidung, wurde vom einfachen Unterscheidungsmerkmal zu einer unabdinbaren Grundlage jüdischen Seins. Das mystische Judentum, dem auch viele Proselyten angehörten (das sind in Lublinskis Sprachgebrauch Nicht-Juden, die zwar an den Mysterien teilnahmen, wohl auch zum jüdischen Gott beteten, aber nicht völlig konvertiert hatten – und sei es nur, weil sie als Erwachsene die Schmerzen und die Komplikationen einer Beschneidung scheuten(ja, Lublinski redet fast ausschließlich von Männern)), das mystische Judentum also konnte – wollte – hier nicht folgen. Da die Mystiker für die Pharisäer die Schuld an der Zerstörung Jerusalems und des Tempels trugen, spitzten sich die Animositäten zu. Irgendwann, so Lublinskis These, trennten sich die Wege blutig: Aus der jüdischen Sekte der Nazarener (oder Christen) wurde eine eigenständige Religion, die nun auch einen eigenen Gründungsmythos benötigte. Dabei fanden seiner Meinung nach einige gegenseitige Pogrome statt.
So weit immer noch gut. Hier aber nun postuliert Lublinski ganz einfach, dass man dem bereits mystisch-mythisch existierenden Sohn Gottes, der bereits den Namen „Jesus“ trug, eine menschliche Biografie unterschob – eine, die etwa 200 Jahre zurück lag und also nicht mehr kontrolliert werden konnte. Warum aber dieses? Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem – es ist bedeutend einfacher und sinnfälliger, anzunehmen, dass die Sekte der Nazarener tatsächlich einen Jesus kannten, der eventuell gar aus Nazaret stammte, der sich „Messias“ nannte und den sie im Laufe der Zeit mit der einen oder anderen Überhöhung (volks-)mythologischer Erzählungen einkleideten. Um über Lublinskis These endgültig entscheiden zu können, fehlt mir zugegeben der oben erwähnte Folgeband – den ich nicht besitze und zu lesen auch nicht beabsichtige. Lassen wir seine These also so stehen…
Fazit: Tatsächlich ein „Curiosum“, das ich als solches hier stehen lasse. Ganz amüsant, 110 Jahre nach seinem Erscheinen aber wohl nicht mehr ganz ernst zu nehmen. Es fehlt auf jeden Fall ein Jahrhundert weiterer Forschung.

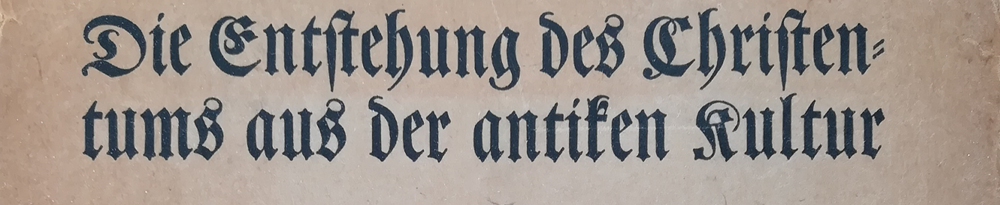
Dankeschön. Ich mag solche Curiosa. Die Frage »Wozu, zu welchem Nutzen hat er oder sie das eigentlich geschrieben?« generiert bei mir einen gewissen Lesereiz. (Beispiel: Sollte ich Arno Schmidts Fouque nicht doch mal von vorn bis hinten lesen?)
Wenn Du Curiosa magst, solltest Du es machen. Ich hab’s mir ja vor zwei Jahren mal angetan. War interessant, auch weil ich von Arno Schmidt doch so einiges schon gelesen habe. Aber die Leselücke war nur physisch groß (> 700 Seiten war der Backstein dick!). Fouqué halte ich – die Undine aussen vor gelassen – für überschätzt. Und Schmidts Monografie für, um Reich-Ranicki zu zitieren (dem ich für einmal Recht gebe): „schon des Themas wegen nicht gerade nötig“.