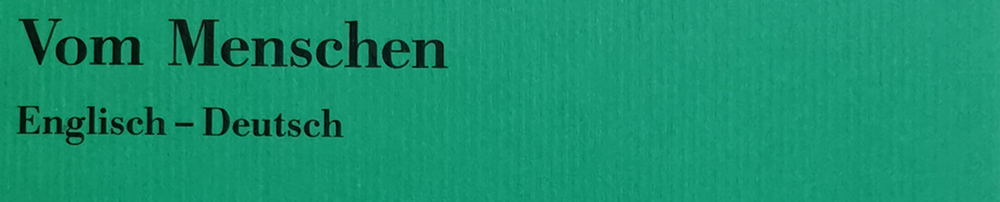Lehrgedichte sind jedem Literaturwissenschaftler und jeder Literaturtheoretikerin ein Graus, weil sie sich einer wirklichen Einordnung in eine literarische Gattung mehr oder weniger entziehen. Sie weisen zwar Aspekte von Lyrik auf (gebundene Sprache, manchmal auch Reime), aber transportieren weder Gefühle noch Ereignisse; auch den ansonsten meist hohen Wert symbolischer Bedeutung geht ihnen wegen der inhärenten Lehrform ab: Sie wollen klar sein und Wissen übermitteln. Am liebsten wohl würde man sie gänzlich ignorieren, wenn – ja, wenn da nicht ein paar ganz große Beispiele existierten, die man unmöglich unter den Teppich kehren kann. Diese Beispiele zwar werden immer seltener gelesen, weil man die Form wohl als veraltet betrachtet. Aber da ist immer noch der berühmte Ahnherr des Lehrgedichts, Lukrez und sein De rerum natura. Er hat zu vielen Nachahmungen angeregt. Die meisten sind vergessen, aber gerade auf dem Grenzgebiet zwischen Philosophie und (Natur-)Wissenschaften stoßen wir noch heute auf den einen oder anderen Namen. Den Schweizer Albrecht von Haller mit dem naturwissenschaftlich orienterten Die Alpen haben auf diesem Blog auch schon vorgestellt. Allerdings gehört er in eben jene Kategorie der allmählich in Vergessenheit geratenen Autoren. Ein wenig besser geht es dem Engländer Alexander Pope. Mit seinem frühaufklärerischen Lehrgedicht Essay on Man bewegt er sich weniger in naturwissenschaftlichen und mehr in anthropologischen oder kulturgeschichtlichen Sphären.
Als vier Briefe an seinen Freund Lord Bolinbroke deklariert, kommentiert Pope in Versform moralische Aspekte des Mensch-Seins ebenso wie Fragen der Theodizee. Es sollte dieses Buch der ersten Teil einer systematischen Auseinandersetzung mit Gott und der Welt werden; aber von den weiteren Teilen fehlt jede Spur. Es steht zu befürchten, dass Pope nie auch nur damit angefangen hatte – vielleicht auch gar nie im Sinn hatte, damit anzufangen. Oder wenn, dann sehr rasch merkte, dass ihm zum großen Systemphilosophen das nötige Sitzleder fehlte.
Pope setzt sich im Essay on Man zunächst einmal mit Miltons Paradise Lost auseinander – zum Teil sogar fast verbatim. Bis heute bekannt geblieben ist der Schlusssatz des ersten Briefs:
One truth is clear, »Whatever is, is right.«
Brief I, Vers 294
Alles, was ist, ist richtig. Aber es ist auch wichtig, zu sehen, dass es für Pope nicht gut ist. Dass es richtig ist, bedeutet vor allem, dass es dem Menschen die Möglichkeit gibt, sich (zum Guten) zu entwickeln. Der Optimismus, der die ganze spätere Aufklärung durchziehen wird – hier nimmt er seinen Anfang. Das hat Pope nicht nur Kritik von pessimistischen Spöttern wie Voltaire eingetragen; auch Lessing und Mendelssohn (in: Pope ein Metaphysiker!) sind mit dem Optimismus Popes nicht einverstanden. (Auch nicht einverstanden übrigens mit der Übersetzung des Essay on Man durch Barthold Heinrich Brockes. Die andererseits dem vorkritischen Kant so gut gefiel, dass er immer wieder Zeilen daraus in seinem naturphilosophischen Werk Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes nach Newtonischen Grundsätzen abgehandelt von 1755 in Brockes Übersetzung zitiert.) Vieles an der zeitgenössischen Kritik hat sich Popes Werk aber auch dadurch eingehandelt, dass sowohl die französischen wie die deutsche Übersetzung – ganz im Stil der Zeit – teilweise grob entstellend waren, da die Übersetzer eigene Überzeugungen mit denen Popes vermischten. Was dann dem Engländer den unberechtigten Vorwurf einbrachte, Spinozist oder Physikotheologe zu sein.
Den auch den alten Kant noch umtreibenden Optimismus der Aufklärung allerdings müssen wir Pope schon ein wenig zuschreiben. Auch wenn wir zugeben, dass die große Erschütterung eben dieses Optimismus durch das Erdbeben von Lissabon erst 22 Jahren nach dem ersten Erscheinen des Essay on Man erfolgt ist, so war er doch wohl auch schon 1733 … sagen wir … nicht in jedem Fall angebracht.
Alexander Pope: Vom Menschen / Essay on Man. Englisch – Deutsch. Übersetzt von Eberhard Breidert. Mit einer Einleitung herausgegeben von Wolfgang Breidert. Hamburg: Felix Meiner, 1993. (= Philosophische Bibliothek 454)