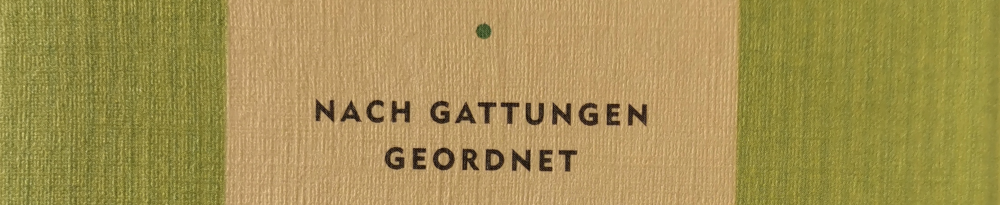Wer sich in der deutschen Literatur der Goethe-Zeit tummelt, wird immer wieder über den Namen Asmus stolpern – Asmus omnia sua secum portans, wie er sich auf dem Titelblatt der Sämtliche[n] Werke des Wandsbecker Boten genau nannte. Ja, noch Raabe konnte ihn ohne Probleme zitieren und Asmus‘ Bekanntheit reicht bis ins 20. Jahrhundert; erst in den letzten fünfzig Jahren oder so ging sie zurück. Heute sind es allenfalls noch ein paar Gedichte, die man kennt. Und bei einigen davon wird man vielleicht nicht einmal mehr wissen, wer der Verfasser war.
Hinter dem Pseudonym Asmus steckte Matthias Claudius, was schon damals alle Welt wusste, denn das Pseudonym war nicht eines, das den Autor verbergen sollte, sondern eine literarische Persona, die Claudius in seinem Wandsbecker Boten verwendete, wenn er Text in der Ich-Form veröffentlichte. Auch Johann Peter Hebel hat sich ja in seinem Rheinischen Hausfreund als ebensolcher hin und wieder in der Ich-Form dem Publikum präsentiert. Der Unterschied zwischen dem Hausfreund und Asmus ist aber signifikant: Während der Hausfreund seinem Gegenüber auf Augenhöhe begegnete und meist auch nur auftrat, wenn es darum ging, (natur-)wissenschaftliche Zusammenhänge zu erklären, ist Asmus‘ Position komplizierter. Wenn Asmus nämlich mit seinem Vetter diskutiert, ist er meist der Lernende, der Belehrte. Ist sein Gegenüber der Tagelöhner Görgel, ist es meist dieser, der von Asmus lernt. Auch sind die Fragen, die diese Personen umtreiben, nicht (natur-)wissenschaftliche, sondern meistens Fragen nach dem richtigen Leben (und Sterben). Denn obwohl beide, Hebel wie Claudius, gläubige Christen sind, ist ihre Einstellung zum Glauben verschieden: Hebel folgte einem rationalistisch fundierten Glauben – er ging davon aus, dass die Natur, aber auch die Taten der Menschen, für sich selber sprechen und einen gütigen Gott bezeugen; Claudius trennte schärfer zwischen Ratio und Gefühl. Obwohl eigentlich Lutheraner, war für ihn der Glaube (als Sache des Gefühls) von der Vernunft so ziemlich geschieden. Deswegen sind seine persönlichen ‚Helden‘ Leute wie Johann Georg Hamann, der mittels einer Mischung aus Vernunft und Glauben die reine Vernunft Kants auszuhebeln versuchte. Oder auch Blaise Pascal, der als einer der ersten der naturwissenschaftlich-mathematischen Vernunft den Glauben entgegen setzte und für sich selber diese Spaltung lebte. Andere Ideale des empfindsamen Claudius sind Spinoza und was er als Spinozisten einstufte: Mendelssohn oder Lessing – nicht zu vergessen die eigentlich Empfindsamen: Klopstock oder Laurence Sterne.
Die im Untertitel meiner Ausgabe erwähnten Gattungen sind folgende: Gespräche, Reden, Briefe, Essays, Kritiken und Gedichte. Davon sind meiner Meinung nach im 21. Jahrhundert nur noch die beiden letzten interessant. Die Kritiken, weil wir darin Claudius in seinem Denken und Glauben, in seinen Widersprüchen auch, am besten fassen können. Da hebt er einen anonym erschienenen Band Oden in den Himmel und verteidigt die reimlosen Verse des Verfassers gegen die orthodoxen Poetologen, die nur gereimte Verse als Gedichte akzeptieren konnten. (Der Verfasser der Oden war, was Claudius nicht wusste, Klopstock.) Andererseits kritisiert er die (ebenfalls zunächst anonym erschienenen) Leiden des jungen Werthers, weil seiner Meinung nach ein derartiger Überschwang der Gefühle, wie ihn Werther an den Tag legt, nicht existieren darf oder zumindest in der Literatur nicht gezeigt werden sollte. So wundert es auch nicht, wenn Claudius – sehr zum Ärger Goethes – Nicolais Pastiche Freuden des jungen Werther’s lobt, weil hier der Werther eben seine Gefühle zu zügeln weiß und zu einem brauchbaren Mitglied der Gesellschaft wird. Ähnliches Unverständnis gegenüber Gefühlen beweist Claudius auch, wenn er Lessings Emilia Galotti zwar im Großen und Ganzen lobt; aber das Detail, dass Emilia beim Anblick der Leiche ihres Geliebten Angst hat davor, dem Charme von dessen Mörder zu erliegen, kann er wiederum nicht nachvollziehen, bzw. möchte es nicht dargestellt sehen. Auf der anderen Seite verteidigt er den Götz von Berlichingen und dessen Sprachgebrauch, oder lobt auch – noch seltsamer, wie ich finde – Lenz‘ Hofmeister. Bei Herders Abhandlung über den Ursprung der Sprache kritisiert er genau den Punkt, den ich als einzig lobenswerten ansehe: den Umstand, dass Herder bei der Darstellung der Entwicklung der Sprache auf den Rückgriff auf Gott verzichtet. Ähnlich ist Claudius dann das nächste Werk Herders suspekt, Auch ein Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit. Er kann mit der Hinwendung zu einer Individualethik und -ästhetik, wie sie die deutsche Klassik unternahm, nicht nur nichts anfangen – er hält sie für eingermaßen bedenklich. Andererseits lobt er einige Aufsätze aus dem berühmt gewordenen Sammelband Von deutscher Art und Kunst, und wenn er über Lavaters Physiognomischen Fragmente schreibt, ist seine Kritik in der Sache praktisch identisch mit derjenigen Lichtenbergs.
Das Unverständnis für ‚große‘ Gefühle zeigt sich auch in Claudius‘ Gedichten. Meist nimmt er den einfachen Menschen, die Natur oder (immer wieder – auch verdeckt) den Tod als Thema, Liebesgedichte finden wir nicht. (Dafür verschiedene Ehegedichte an seine Gattin Rebekka – die gefestigte und über Jahre bewährte Liebe entsprach wohl Claudius‘ eigenem Gefühlsleben besser als der junge Liebesrausch.) In den Gedichten aber bewährt sich Claudius Sprache am besten. Sein Wortschatz ist einfach, sein Versmaß ebenso. Und doch gelingen ihm wunderhübsche Naturbilder. Es ist also nur allzu verständlich, dass solche Gedichte nicht nur volkstümlich geworden sind, sondern auch bis heute überlebt haben. Wenn man von Claudius nur ein paar wenige Sachen lesen möchte: Ich empfehle eine Auswahl seiner Gedichte.
Matthias Claudius: Ausgewählte Werke. Nach Gattungen geordnet. Mit Einleitungen und einem Nachwort herausgegeben von Winfried Freund. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004. (In der Edition Lambert Schneider)
(Eine, wie ich finde, recht gelungene Auswahlausgabe. Ob man – außer, man sei Germanist und Literaturhistoriker – im Jahr des Herren 2021 den ganzen Claudius noch zur Kenntnis nehmen soll, wage ich zu bezweifeln. Aber ein paar ausgewählte Sachen zu kennen, ist sicher nicht falsch. Und Matthias Claudius hat, vor allem bei den Gedichten, ein paar wunderhübsche Sächelchen geschrieben.)