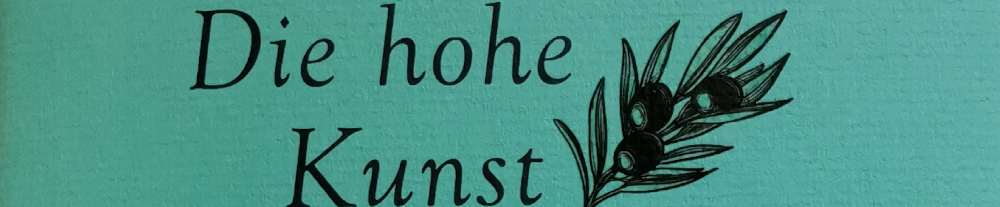Als ich noch studierte, war Otfried Höffe Professor für Philosophie an einer benachbarten Universität. Ich meine, ich hätte ihn sogar einmal an einer Gastvorlesung gehört. Jedenfalls verband ich mit dem Namen durchaus positive Assoziationen – ohne jedoch genau sagen zu können, warum. Als ich dann in den Neuerscheinungen dieses Jahrs (2023) des Verlags C. H. Beck sein Buch mit dem Titel Die hohe Kunst des Verzichts sah, war es für mich klar, dass ich das lesen musste – um so mehr, als dass die über uns hereinbrechende Klimakatastrophe in einer schon ziemlich nahen Zukunft von uns (der Menschheit, vor allem der der ersten Welt) ziemlich viele Verzichte abfordern würde, Verzichte, die wir jetzt gerade noch freiwillig leisten können, schon bald aber werden leisten müssen, weil wir keine Wahl mehr haben. Und ich hoffte, in der Kleinen Philosophie der Selbstbeschränkung (so der Untertitel von Höffes Buch) Anregungen, Hilfestellungen oder auch nur neue Ideen zu diesem Thema zu finden.
Um es vorweg zu nehmen: Die gibt es hier nicht. Grob gesagt, kann man das Buch in zwei Hälften unterteilen. Da ist die philosophiegeschichtliche, in der Höffe sich als durchaus profunder Kenner der politischen Philosophie und der Rechtsphilosophie beweist und auch in Sachen Ethik und ethisches Handeln einiges weiß. (Wenn er allerdings meint, dass eine Anarchie ohne Frage dazu führen müsse, dass brutale Gewalt obsiege, womit er letztlich Hobbes’ Argumentation übernimmt, so muss ich diese apodiktische Formulierung doch zurück weisen. Hobbes’ politische Theorie kann nämlich durchaus in Frage gestellt werden, wurde sie ja auch in der weiteren Geschichte der politischen Philosophie.) Und dann ist da der auf die Gegenwart bezogene Teil. Die erste Hälfte stellt eine einigermaßen solide Zusammenstellung dar politischer und persönlichkeitsbildender Verzichts-Ideale in der Philosophiegeschichte.
Meine Überraschung aber war gross, als Höffe in Kapitel 3, Menschsein steigern: Lebensideale nicht nur auf die epikuräischen und stoischen Selbstbeschränkungsoptionen zu sprechen kommt, sondern auch auf die Drei Prunkworte: Armut, Demut, Keuschheit und dabei unter anderem auf das Mönchstum. Dazu passt, dass das nächste Zwischenspiel folgendermaßen betitelt ist: Erfüllung durch Verzicht: Hohe Minne und er noch später auch den Geist des Kapitalismus? aus Max Webers Theorie von dessen Herkunft aus der protestantischen Arbeitsethik herleitet. Dazu passt, dass er die stoische Apatheia der epikuräischen Ataraxie vorzieht, was sich zusehends in der Auswahl der Beispiele von Verzicht zeigt. Höffes Christentum drückt in dieser Schrift schon sehr durch.
Allerdings hatte mich Höffe schon lange vorher enttäuscht – nämlich, als er die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie (die – da gehe ich mit ihm noch einig – einen staatlich eingeforderten Verzicht auf manches bedeuteten) als in manchen (vielen?) Fällen übertrieben darstellte. Das darf man, es hinterlässt aber ein ‚Gschmäckle‘ intellektueller Unredlichkeit, wenn man weiß, dass Höffe Mitglied war von Armin Laschets „Expertenrat Corona“ – offenbar hat Höffe dort auch kein Mittel gefunden, diesen aufgezwungenen Verzicht zu kompensieren.
Völlig überflüssig war dann sein Exkurs zum Thema des generischen Maskulinum in der deutschen Sprache. Offenbar hat er sich darüber geärgert, dass verschiedene Universitäten (darunter wohl auch seine?) forderten, dass in offiziellen Dokumenten (und dazu gehören offenbar auch welche, die von den Professor:innen geschrieben werden, auch den emeritierten) gendergerechte Sprache verwendet werden solle. Gerade noch hat Höffe von Toleranz gesprochen, gleich wird er vom Weg der Mitte des Aristoteles sprechen – hier aber, wo es ihn persönlich juckt, kratzt er unbesonnen drauf los. Alle Sprachwissenschaftler, meint er (und verwendet natürlich gleich das generische Maskulinum!) hielten dies für unhistorisch und seien dagegen. Nun können Sprachwissenschaftler:innen natürlich auch eine eigene, private Meinung zu diesem Thema haben. Aber als Wissenschaftler:innen werden sie den Sprachwandel oder einen Versuch, die Sprache zu wandeln, bestenfalls mit Interesse verfolgen. Und wenn Höffe dann noch schreibt, dass diese universitären Institutionen offenbar durch forcierten Gebrauch gendergerechter Sprache versuchen, beim Duden eine Änderung der Sprachnorm durchzudrücken, hat er vergessen (oder nie realisiert), dass der Duden schon seit längerem vom vom normativ-gymnasiallehrerhaften Ideal seines Gründers abgekommen und zu einer sprachwissenschaftlichen Beschreibung der aktuellen Verwendung gelangt ist. Ein Lektorat, das Biss zeigen würde oder könnte, hätte ihm diese Passage streichen müssen. (Aber ich zweifle mittlerweile, ob beim Verlag C. H. Beck noch ein Lektorat existiert.) Höffe zeigt sich hier einfach nur als verärgerter alter weißer Mann, und selten kann folgender Satz besser angebracht werden als hier: Si tacuisses, philosophus mansisses.
Alles in allem also nicht, was ich erwartet hatte (aber ich hatte wohl einfach zu viel bzw. das Falsche erwartet), sondern der Versuch eines konservativ-katholisch-liberalen, stoizistischen Denkers, seine Welt zu beschreiben. (Versuch. Er spricht von seiner Schrift denn auch immer wieder als von einem Essay).)
Otfried Höffe: Die hohe Kunst des Verzichts. Kleine Philosophie der Selbstbeschränkung. München: C. H. Beck, 2023.