Universitätsdozent:innen und Schriftsteller:innen haben eines gemeinsam: Sie müssen regelmäßig mit Publikationen auf sich aufmerksam machen – in einer ersten Phase der Karriere, um bekannt zu werden, dann, um bekannt zu bleiben. Während Universitätsprofessor:innen (zumindest in den MINT-Fächern) den Ausweg gefunden haben, die Arbeiten ihrer Assistent:innen und Student:innen als Co-Autor:innen herauszugeben, bleibt dies anderen verwehrt. Besonders schwierig kann die Situation für Sachbuch-Autor:innen werden, denn ein Sachbuch erfordert im Normalfall einiges an Recherche. Dann kann es halt vorkommen, dass es mittlerweile eilt mit einer Publikation. Was seinerseits gern zur Konsequenz hat, dass – schludrig gearbeitet wird.
Und genau das war, vermute ich, hier der Fall. Sarah Bakewell schreibt zwar irgendwo in diesem Buch, sie hätte daran schon vor der Pandemie gearbeitet, was doch ungefähr eine Arbeitszeit von drei Jahren bedeuten würde (das Buch ist auf Englisch wie auf Deutsch dieses Jahr – 2023 – erschienen).
Leider aber weist es – anders als ihre beiden Bücher zu den französischen Existenzialisten und Montaigne respektive – zu viel auf, das nicht zusammen passt. Vielleicht war auch die gewählte Periode, von Petrarca bis zur Gegenwart, also rund 700 Jahre, ganz einfach zu groß. Für eine solch lange Periode hätte das Buch wohl mindestens das Doppelte seines aktuellen Umfangs von 500 Seiten haben müssen. Und wäre wohl immer noch in Arbeit.
Ich bin nun kein Spezialist für all die 700 Jahre, die Bakewell hier beschreibt. Ich bin überhaupt kein Spezialist für irgendeine dieser Epochen. Ich bin für einige Epochen vielleicht eine Art informierter Laie. Aber wenn sogar ich als Laie größere und kleinere Flüchtigkeitsfehler feststellen muss …
Zwei Beispiele, die ich als besonders bedrückend empfinde, weil Bakewell beide Male in ihrer Flüchtigkeit andere Frauen in ein, wie ich finde, seltsames Licht rückt.
So heisst es auf Seite 85:
Das Buch von der Stadt der Frauen entstand 1405. Es ist eine Sammlung von Geschichten, die sich auf Boccaccios Porträts berühmter Frauen in Mythos und Geschichten (De mulieribus claris) stützt […].
Das ist nicht falsch, aber unvollständig und stellt Christine de Pizan in eine einseitige Abhängigkeit von einem einzigen (männlichen) Autor – sie, die äußerst belesen war und für Das Buch von der Stadt der Frauen verschiedenste Quellen ausgewertet hat. (Mag sein, in dubio pro reo, Bakewell ist einer falschen Information der englischen Ausgabe aufgesessen.)
Eine andere Frau, die Bakewell – in gutem Willen – in ein schiefes Licht stellt, ist die Physikerin Émilie du Châtelet. Bakewell kommt auf sie zu sprechen in Zusammenhang mit den französischen Aufklärern Rousseau und Voltaire, von denen ersterer zwar sehr für Aufklärung, Ausbildung und Gleichberechtigung war – solange es nicht die Frauen betraf, die ja noch in der Französischen Revolution nicht beachtet wurden. Olympe de Gouges, die den von der Revolution propagierten „Droits des hommes“ (die eben Männerrechte und nicht Menschenrechte waren!) auch die Frauenrechte („Droits des femmes“) gegenüber zu stellen versuchte, wurden von den männlichen Revolutionären zum Tod durch die Guillotine verurteilt. Aber zurück zu Émilie du Châtelet, die bei Bakewell nun im Zusammenhang einer Ehrenrettung Voltaires genannt wird, und von der es bei Bakewell deshalb Folgendes heisst (S. 224):
Voltaire hielt Frauen durchaus für gute Wissenschaftlerinnen. Mit seiner Freundin und Geliebten, der Mathematikerin und Übersetzerin Émilie du Châtelet, tauschte er sich unter anderem über die Newton’sche Physik aus.
Frau kann durchaus mit Recht den auch bei den Aufklärern halt immer noch patriarchalischen Blick auf die Rolle der Frau monieren. Aber dann muss frau auch unbedingt auf die eigenen Formulierungen aufpassen und nicht eine der besten Physikerinnen beider Geschlechter jener Zeit in reiner Abhängigkeit zu einem Mann darstellen – auch dann nicht, wenn dieser Mann der relativ unpatriarchalische Voltaire ist. Émilie du Châtelet war bedeutend mehr und anderes als die Geliebte Voltaires. (Ihr Liebesleben übrigens war sogar recht komplex, und es wundert mich, dass Sarah Bakewell, die sonst gerne Anekdoten aus dem Liebes- und Sexualleben ihrer Protagonist:innen erzählt, hier nicht zugegriffen hat.)
Überhaupt – Bakewells Vorliebe für Anekdoten. Sie hat diese ja schon in den beiden anderen Büchern ausgelebt, die ich von ihr gelesen und hier auch vorgestellt habe. Aber dort waren sie Teil eines größeren Ganzen – und bei der Darstellung Montaignes, dessen Essais, spätestens ab Band 2, stark mit seinem eigenen Leben verknüpft waren, vielleicht sogar unumgänglich. Hier aber nun lesen wir jede Menge Anekdoten, aber über das eigentliche Denken oder Schreiben selbst der hervorgehobenen Personen erfahren wir kaum etwas. Das Buch wird dadurch sehr oberflächlich.
Auch kann ich die Gewichtung Bakewells (dort, wo ich mich ein bisschen auskenne) nicht immer nachvollziehen. Dante wird so nebenbei als eine Art Vorläufer Petrarcas behandelt. Dabei muss er durchaus auch schon zum Frühhumanismus gezählt werden mit seiner Verwendung des Vernakular (d.i. der florentinischen Umgangssprache), auch wenn natürlich die Divina Commedia im Ganzen ein scholastisch-theologisches Werk darstellt. Ähnlich verfährt Bakewell mit Marsilio Ficino, dem großen Platon-Übersetzer und führenden Neuplatoniker seiner Zeit, dessen Denken den ganzen Humanismus geprägt hat. Er hat hier die Rolle eines Vorläufers ihres Lieblings Lorenzo Valla inne.
Wenn sie dann Boccaccios Ringparabel als Beispiel aufführt für die religiöse Toleranz (die für sie ein Aspekt des Humanismus ist – durch alle Zeiten hindurch), dann aber offenbar nichts von Lessing weiß, macht sich ein anderer Schwachpunkt des Buchs bemerkbar. Das Buch ist nicht nur eurozentrisch ausgerichtet; Bakewell fokussiert – aus welchen Gründen auch immer – vor allem auf die diversen Strömungen in Italien (vor allem Florenz), in Großbritannien und in Frankreich. Deutsche Aufklärung? Ja, Kant – um den kommt man in der europäischen Philosophiegeschichte nicht herum. Wilhelm von Humboldt, wenn man den zur Aufklärung zählen will; aber er figuriert hier vor allem als Bildungspolitiker mit seiner Einrichtung der modernen Universität. Später dann ein paar Linkshegelianer (Strauß und Feuerbach), für die es in der Philosophiegeschichte der restlichen Welt kein Äquivalent gibt, die aber für Bakewell in der Geschichte des Atheismus wichtig sind. Schlussendlich, im Kampf gegen nationalsozialistisches und faschistisches Denken, die vier Manns: Heinrich, Thomas, Klaus und Erika. Wiederum aber sind die ideologischen Differenzen im Denken der vier viel zu wenig herausgearbeitet. Ansonsten ist deutsches Denken offenbar inexistent.
Je mehr sich Bakewell auf ihrem Zeitstrahl von dem wegbewegt, was wir heute geistesgeschichtlich als ‚Humanismus‘ bezeichnen, je mehr sie von der Aufklärung in die Gegenwart kommt, desto verwaschener wird der Begriff ‚Humanismus‘ bei ihr. Das endet (für mich jedenfalls) damit, dass Lesende gar nicht mehr wissen, was Bakewell nun genau vorstellen möchte. Irgendwann – ungefähr am Ende des 19., im 20. und schließlich im 21. Jahrhundert, scheint mir das Ganze nur noch ein Werbespot zu sein für die britische Humanist Society, deren konkreten Ziele mir aber auch nicht klar geworden sind. Was die Zeit nach der Aufklärung betrifft, war das Buch zumindest für mich verlorene Lesezeit.
Ich will nun die Schuld am Desaster, das dieses Buch darstellt, nicht allein Sarah Bakewell in die Schuhe schieben. Ich kenne das englische Original nicht, nur die deutsche Übersetzung. Und in mindestens einem Punkt ist sie fehlerhaft (einem vermeidbaren Fall, nebenbei, wenn man den Text noch einmal durchgelesen hätte – Lektorate und Korrektorate scheint es heute auch bei Großverlagen nicht mehr zu geben), und was den Buchtitel überhaupt betrifft, nur dann verständlich, wenn wir ihn durch die Brille einer Marketingspezialistin betrachten. Das Original führt den Titel Humanly Possible, also „menschenmöglich“. Die Marketingspezialistin hielt es offenbar für einen klugen Schachzug, den deutschen Titel des Montaigne-Buchs von Bakewell auszugraben (Wie soll ich leben?) und erweckt damit im Publikum Hoffnungen auf eine Art Ratgeber, der diese Geschichte des Humanismus so gar nicht sein will noch kann. Der Zwischentitel (ich nenne ihn mal so, weil er offenbar weder Ober- noch Untertitel ist) lautet im Deutschen Auf den Spuren der HUMANISTEN [Versalien im Original]. Im englischen Original fehlt er ganz. Schließlich der Untertitel: Im Deutschen finden wir hier Freies Denken, Neugierde und Glück von der Renaissance bis heute. (Der ist schon sachlich problematisch: Der Frühhumanismus, Dante, Petrarca, Boccaccio und Christine de Pizan zum Beispiel, wird im Normalfall noch nicht zur Renaissance gezählt.) Im Englischen haben wir Seven Hundres Years of Humanist Freethinking, Enquiry and Hope. Da hat sich der deutsche Verlag C. H. Beck bei der Übersetzung des Titels also einige Freiheiten herausgenommen. Das englische „Freethinking“ ist eigentlich ein Euphemismus für Atheismus (allenfalls Agnostizismus, welches Wort aber oft seinerseits als Euphemismus dient für Atheismus). Auf Deutsch spricht man von einem „Freidenker“, aber nicht von einem „freien Denker“. Hatte man bei C. H. Beck Angst, mit „Freidenker“ Assoziationen zu wecken an das seit ein paar Jahren in übelsten Verruf gekommene Wort „Querdenker“? „Enquiry“ dann ist mehr als bloße „Neugierde“, sondern meint eine konkrete (oft wissenschaftliche) Untersuchung. „Hope“ schließlich ist „Hoffnung“. Bakewell spricht zwar auch einmal vom Erreichen des Glücks durch Humanismus, ist aber im Normalfall hier sehr vorsichtig. Der deutsche Titel weckt Hoffnungen, die von der Autorin nicht erfüllt werden können – pun intended.
Schließlich noch ein Fundstück, das meiner Ansicht nach klar beweist, dass das Buch viel zu rasch auf den Markt – zumindest auf den deutschen Markt – geworfen wurde:
Seite 50 heißt es auf Deutsch (es geht um die Pest, die Italien zur Zeit Petrarcas und Boccaccios gerade heimsuchte):
Sie [eben die Pest] wurde durch das Bakterium Yersinia Pestis verursacht, das durch Flöhe und andere Vektoren übertragen wurde, aber das wusste damals natürlich noch niemand.
Flöhe als mathematische Objekte? Natürlich nicht. „Vector“ hat im Englischen, anders als im Deutschen, zwei Hauptbedeutungen – und hier ist die andere gemeint: „Träger bzw. Überträger von Krankheiten“ (wie uns auch in Blick in eine Nachbarsprache zeigt, ins Niederländische). Stand die Übersetzerin (Rita Seuß), die schon Bakewells Montaigne-Buch übersetzt hat, hier derart unter Zeitdruck? Oder wurde hier (wohl wiederum wegen Zeitmangel) zunächst eine maschinelle Rohübersetzung angefertigt? Ich tendiere zu letzterem, denn einem deutschsprachigen Menschen kann so ein Fehler eigentlich nicht unterlaufen.
Fazit: Eine schludrige Arbeit, bei der wir nicht einmal erkennen können, was deren Sinn und Zweck eigentlich hätte sein sollen. Was definitiv Bakewell zuzuschreiben ist. Zu viele Ungenauigkeiten und Fehler auf den paar Seiten, bei denen ich es halbwegs kontrollieren konnte. Woran zum Teil auch die deutsche Übersetzung und der deutsche Verlag schuld sind oder sein könnten. Alles in allem aber kann ich nur sagen: Man spare sich oder seiner Bibliothek das Geld für die Anschaffung dieses Buchs.
Last but not least haben wir zwar ein Personenregister, aber kein Literaturverzeichnis. So weiß ich zwar aus den Endnoten, dass Sarah Bakewell mindestens zwei Publikationen von Peter Burke verwendet hat, ob aber sein Standardwerk The Italian Renaissance ebenfalls zur konsulitieren Literatur gehört, erfahre ich nicht. Es zu lesen, hätte sie jedenfalls vor einigen Ungenauigkeiten bewahren können. Der Grundriss Philosophie des Humanismus und der Renaissance (1350-1600) von Thomas Leinkauf ist, vermute ich, nicht ins Englische übersetzt worden – schade, er hätte Bakewell für diese Epoche eine große Hilfe sein können.
Die Publikationsdaten können dem Aperçu entnommen werden.

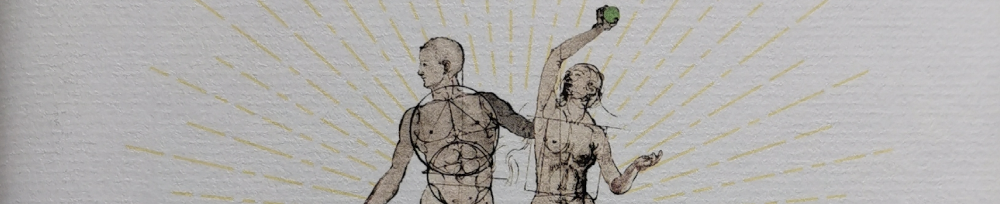
Danke für diese sehr informative Besprechung, damit kann ich etwas anfangen und bewahrt mich vor dem Kauf des Buches.