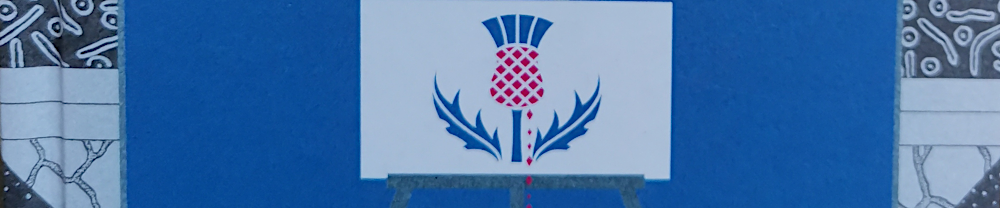Bettina Schnerr hat mich in ihrem Blog Bleisatz auf diese Neuausgabe des Kriminalromans Fünf falsche Fährten aufmerksam gemacht. Sie ist bei Wunderlich erschienen, einem Imprint von Rowohlt1). Auf dem Cover aus Hartpappe ist eine überarbeitete Version des Titelbilds der Erstausgabe des Romans bei Hachette UK abgebildet; die Übersetzung ist die von Otto Bayer – also keine Neuübersetzung.
Bettina Schnerr verdankte den Buchtipp ihrerseits einer Empfehlung, an deren Urheber:in sie sich allerdings nicht mehr erinnert. Jedenfalls rätselt sie in ihrem Artikel, warum dieser Roman damals so warm empfohlen wurde; sie selber konnte sich offenbar nicht ganz anfreunden damit.
Mir für meinen Teil haben die beiden Zitate, die sie in ihrem Artikel aus dem Roman bringt, jedenfalls sehr gefallen. Das, und wie es Bettina Schnerr formuliert hat: Mit Wimsey kann man eigentlich nie etwas falsch machen, hat mich dann dazu bewogen, den Roman zu kaufen. Ich kannte ihn nämlich als eine der wenigen Wimsey-Geschichten noch nicht. Nun lese ich Kriminalromane ganz anders als Schnerr, was vielleicht erklärt, warum ich für meinen Teil mich bei der Lektüre dieses Romans königlich amüsiert habe. Der wichtigste Unterschied zwischen uns beiden ist wohl, dass ich gar nicht erst versuche, den Mörder zu erraten, weil ich trotz einigen Studiums der Logik dazu zu dumm bin. Sayers tut hier nämlich mehr als andere, um dieses Erraten unmöglich zu machen, was mich – eben weil ich es gar nicht erst versuche – auch nicht frustrieren kann.
Kommen wir nun zum Roman. Mit rund 475 Seiten ist er für einen Krimi recht lang geraten. Aber Sayers hat sich auch jede Mühe gegeben, und gleich fünf falsche Fährten gelegt. (Der englische Ausdruck Red Herring stammt ursprünglich aus dem Jagdwesen und weist auf den fälschlich für wahr genommenen Glauben, dass Jagdhunde durch den intensiven Geruch geräucherter Heringe (die beim Prozess des Räucherns offenbar rot werden) von der eigentlichen Fährte abgelenkt werden können. Damit unterschätzt man aber die Spürnase eines Jagdhundes ebenso wie die von Lord Peter Wimsey.)
Ausgangssituation ist eine Künstlerkolonie in Schottland, im selben Ort, in dem auch Lord Peter Wimsey gerade Urlaub macht. (Wovon ein steinreicher Lord Urlaub machen muss, wird nicht erklärt.) Wir treffen auf einen gewissen Campbell – einen Maler, der das Kunststück zustande gebracht hat, sich gleich mit sechs Malerkollegen derart zu verkrachen, dass, als sein Körper tot in einem Bach gefunden wird, gleich alle sechs als Mörder in Frage kommen. So weit, so gut.
Dorothy Leigh Sayers aber liefert mehr als einen klassischen ‚Who dunnit?‘. Sie liefert ein Meisterstück ab, wie die Regeln des Kriminalromans gleichzeitig perfekt angewendet und ad absurdum geführt werden können. Sie war Mitglied (Gründungsmitglied sogar!) des so genannten Detection Clubs, einer Gruppe von Mystery-, Science-Fiction- und Kriminalautoren. Der Club existiert noch heute; damals vereinigte er einige der bekanntesten Namen des Genres. In diesem Club wurden auch Regeln zum Verfassen von Kriminalromanen aufgestellt – nicht ganz ernst gemeinte, und viele Mitglieder des Clubs verstießen denn auch gegen die eine oder die andere. Nicht aber, werden wir noch sehen, Sayers in den Five Red Herrings, im Gegenteil. Hier aber zunächst die Regeln, wie sie in Wikipedia zu finden sind:
- Der Verbrecher muss bereits zu Beginn der Geschichte Erwähnung finden, aber es darf niemand sein, dessen Gedanken der Leser folgen kann.
- Übernatürliche Kräfte oder Mächte sind selbstverständlich untersagt.
- Es darf nur eine Geheimkammer respektive nicht mehr als ein Geheimgang verwendet werden, und dies auch nur dann, wenn sich die geschilderte Umgebung dazu eignet.
- Weder sind bis jetzt unbekannte Gifte gestattet noch irgendeine Art der Verabreichung, die am Ende eine lange wissenschaftliche Erklärung erfordert.
- Chinesen haben in der Geschichte nichts zu suchen. [Zur Zeit, als diese „Gesetze“ formuliert wurden, war es eine Seuche des Genres, exotische Täter zu präsentieren. – P. H.]
- Weder darf der Zufall dem Detektiv zu Hilfe eilen, noch darf er unerklärliche Eingebungen haben, die sich als richtig herausstellen.
- Der Detektiv darf das Verbrechen nicht selbst begehen.
- Alle Spuren, auf die der Detektiv stößt, müssen dem Leser unverzüglich vor Augen geführt werden.
- Der beschränkte Freund des Detektivs, sein Watson, darf keinen seiner Gedankengänge verschweigen; sein Intelligenzquotient muss leicht, aber nur ganz leicht, unter dem des durchschnittlichen Lesers liegen.
- Zwillinge und Doppelgänger dürfen erst auftreten, nachdem wir gebührend auf sie vorbereitet worden sind.
Sayers hält also diese Regeln in Fünf falsche Fährten ein – wörtlich, und das ist genau der Clou. Das widerspricht auch der von Bettina Schnerr monierten Passage auf Seite 39 nicht, wo es heißt:
(An dieser Stelle erklärt nun Lord Peter Wimsey dem Sergeant, wonach er suchen soll und warum, doch da der intelligente Leser dieses kleine Detail sicher selber beisteuern kann, bliebt es auf dieser Seite unerwähnt.) [Klammern im Original]
Das widerspricht, wörtlich genommen, nicht der Regel 8 (es handelt sich nämlich nicht um die Existenz einer Spur, sondern um die Nicht-Existenz einer Spur, wie wir zum Schluss erfahren), umso mehr, als der Leser das Detail theoretisch tatsächlich beisteuern könnte. Gleichzeitig haben wir hier ein schönes Beispiel, wie Sayers nicht nur mit den Regeln des Detektivromans spielt, sondern gleichzeitig auch mit ihren Leser:innen.
Die Regeln des Detektivromans aber persifliert sie meiner Meinung nach bereits auf Seite 30, wenn nämlich Wimsey sich an den Ort des Verbrechens aufmacht:
Die Strecke zwischen Kirkcudbright und Newton Stewart ist von einer abwechslungsreichen, schwer zu übersehenden Schönheit, und mit einem Himmel voll strahlendem Sonnenschein und aufgetürmten Wolkenbänken, den blühenden Hecken, einer gut ausgebauten Straße, einem temperamentvollen Motor und der Aussicht auf eine schöne Leiche am Ende der Reise fehlte Lord Peter nichts zu seinem Glück. Er war ein Mensch, der sich an kleinen Dingen freuen konnte.
Breitestes Grinsen auf meinem Gesicht. Die Aussicht auf eine schöne Leiche ist ja genau das, was so viele Menschen Kriminalromane lesen lässt, oder? Und wenn Wimsey später dann am Kopf des Toten herumdrückt, um die Delle im Schädel zu finden, die dessen Tod verursacht hat – ist das nicht das geschätzte Publikum, das liebevoll die grausigsten Todesarten erklärt haben will?
Vom Whisky-Konsum der Maler-Protagonisten will ich schweigen. Ich halte es für ein medizinisches Wunder, dass wir nicht gleich von Anfang an sieben Alkohol-Leichen vor uns haben – sturzbetrunken sind alle einmal im Verlauf der Geschichte.
Nun aber die fünf falschen Fährten … Es sind ja nicht einfach nur die sechs verdächtigen Malerkollegen, von denen fünf Red Herrings darstellen. Es ist eine ungeheuer komplizierte Vernetzung von Fahrten und Wegen: Hin zum Tatort, zurück nach Hause – oder doch gleich zum Bahnhof, mit der Leiche, ohne Leiche … Was immer es an Transportmitteln damals gab (das Flugzeug ausgenommen) wird von der Autorin aufgeboten: Fußmärsche, Fahrräder (neue und alte, kaputte und funktionierende), Automobile (schnelle wie Klapperkisten), die Bahn – selbst ein Segelschiff darf nicht fehlen. Und welch komplizierten Berechnungen werden nicht angestellt, um festzustellen, ob ein möglicher Täter wirklich diesen oder jenen Zug an dieser oder jener Haltestelle hätte erreichen können, um zu dieser oder jener Zeit dann dort oder dort gewesen oder eben nicht gewesen sein zu können. (Die von der Autorin verwendeten Abfahrtszeiten und Haltestellen sind meines Wissens sogar real.) Zu allem Überfluss wird fürs Publikum noch eine Karte von Galloway vorgeschaltet, so, dass es allenfalls selber nachmessen und -rechnen kann. Man kann nicht sagen, dass Sayers ihrem Publikum nicht alles bieten würde, das es für sein Geld verlangen kann.
Selbst die Auflösung ist noch mit dieser ihrer Ironie gespickt. In zwei ganzen langen Kapiteln lässt die Autorin jeden in den Fall verwickelten Polizisten seine Theorie vorstellen, welcher der sechs verdächtigen Maler nun wirklich der Täter sei. Abermals werden Fahrpläne misshandelt, Strecken und die Zeit zu deren Zurücklegung mit diesem oder jenem Verkehrsmittel diskutiert. Zum Schluss erst, in einem weiteren Kapitel wird dem Amateur Lord Peter das Wort gegeben. Und noch einmal gibt die Autorin alles an Ironie, um dem Leser die Unwahrscheinlichkeiten des klassischen Kriminalromans vor Augen zu führen, wenn sie S. 407 schreibt:
«Dies ist», sagte Lord Peter Wimsey, «der stolzeste Augenblick meines Lebens. Endlich fühle ich mich wahrhaft wie Sherlock Holmes. Ein Polizeipräsident, ein Polizeiinspektor, ein Polizeisergeant und zwei Konstabler rufen mich als Schiedsrichter zwischen ihren Theorien an, und ich kann mich, die Brust geschwellt wie ein Täuberich, in meinen Sessel zurücklehnen und sagen: ‹Meine Herren, sie liegen alle falsch.›»
Schon die Tatsache, dass da alle Ermittelnden auf einem Haufen sitzen und sich gegenseitig in aller Ruhe ihre Theorien erzählen, ist ja ein Standardmotiv der Auflösung im Kriminalroman. Mit der Anzahl Teilnehmer, der Anzahl Verdächtiger und der Komplexität der vorgebrachten Theorien wird dieses Motiv von Sayers endgültig ad absurdum geführt. Im Übrigen stelle man sich das genau vor: Sherlock Holmes hatte normalerweise nur einen, bestenfalls und ausnahmsweise zwei Berufsdetektive, denen er in solchen Sitzungen erklären musste, wie sich der Mord wirklich abgespielt hatte. Wimsey sticht gleich fünf Polizisten aus.2)
Ich habe mich, wie bereits gesagt, königlich amüsiert. Vielen Dank, Frau Sayers, für diesen herrlichen Roman!
1) Offenbar ein so unwichtiges Imprint, dass im Impressum gleich der Rowohlt-Velag angegeben wird, mit Erscheinungstermin November 2022.
2) Wer die so genannten Spoiler nicht mag, soll hier einfach nicht weiter lesen …
Es geht dann noch weiter, indem es sich Schluss herausstellt, dass es nicht einmal ein Mord war. Campbell stürzte im Rahmen einer im Suff selber provozierten Schlägerei mit einem Kollegen derart unglücklich, dass er sich an einem Vorsprung eines Holzofens den Schädel einschlug. Warum der andere Raufbold das nicht von Anfang an zugab, sondern ungeheuer komplizierte Ablenkungsmanöver improvisierte, bleibt dann aber das Geheimnis der Autorin.