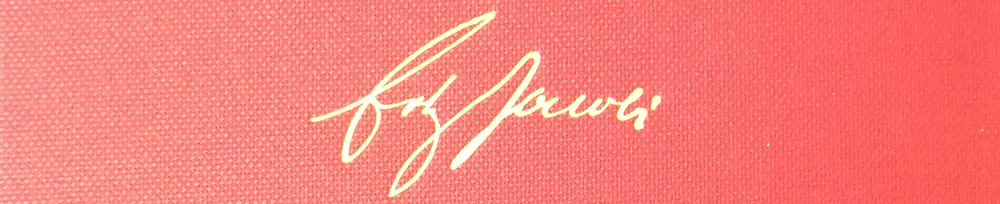Unter dem Titel Eduard Allwill veröffentlichen die Herausgeber der Kritischen Ausgabe von Jacobis Werken zwei Fassungen desselben Textes: Eduard Allwills Papiere von 1776 und Eduard Allwills Briefsammlung von 1792, denen sie jeweils Varianten zuzählen. Die erste Fassung, mit einem (anonymen) Zitat von Goethe einsetzend, Lavater und Shaftesbury zitierend, orientiert sich in Stil und Inhalt stark an Rousseau, wirkte seinerseits auf den Werther, und ist aus heutiger Sicht ein Paradebeispiel empfindsamen Schreibens. Interessanterweise – und das wäre eine intensivere Studie wert, wie ich finde – wird in den mehr philosophisch-theoretisch ausgelegten Werken der Mann, den Jacobi seine Protagonisten immer und immer wieder zitieren lässt, kaum erwähnt. Ich meine Montaigne, den Skeptiker, aus dem die Briefschreiber des Allwill (in beiden Fassungen übrigens!) immer wieder positive Be- und Verstärkung ziehen.
Jacobi warnt in seinem Vorbericht
In der That sind hier die Menschen fast das einzige Interessante: wer sich mit diesen nicht befreunden; wer überhaupt durch das Leben, so wie es sich gewöhnlich in unserer Werktags-Welt ergibt, ohne herzliche Theilnehmung an allem durchschleichen kann, der muß viele Briefe dieser Sammlung äußerst schaal und langweilig finden. Und da ich nun so eben belehret worden [in Nicolais Allgemeiner deutscher Bibliothek – P.H.], daß selbst ein eigentlicher Roman nur zu den Auswüchsen der Litteratur gerechnet zu werden pflege; so muß mir mein eigen Gewissen sagen, daß dergleichen wie Allwills Papiere wohl gar nur Unkraut sey, welches kein anderer als ein Feind unter den reinen Weizen unserer Litteratur zu säen die Pflichtvergessenheit haben mag.
Captatio benevolentiae und Widerborstigkeit gegen Konventionen in einem. Jacobi warnt uns also gleich, dass sich in diesem Text wenig ereignen werde, und tatsächlich ereignet sich – gar nichts. Es gehen ein paar Briefe hin und her, bei denen sich vor allem die Sylli genannte Gesprächspartnerin, mit der der Briefwechsel einsetzt, dadurch auszeichnet, dass sie die Welt und ihr Leben eher düster sieht. Die Figuren sind einigermaßen von einander unterscheidbar, jede hat einen eigenen Charakter – aber daraus ergibt sich kein Gesamtbild.
Kein Wunder, dass das Vakuum an Inhalt vom Publikum gleich auf andere Art mit Sinn gefüllt werden musste. Schon beim Erscheinen der ersten Briefe (noch in der kurzlebigen Zeitschrift Iris: Vierteljahreschrift für Frauenzimmer, die sein Bruder Johann Georg von 1774-1776 herausgab) begann man darüber zu spekulieren, wer mit den Personen, die hier Briefe wechselten, gemeint sein könne. So ging die spätere Frau Boies, Luise Mejer, (nicht als einzige) davon aus, dass mit Clerdon Jacobi sich selber meine, mit dessen Frau seine eigene Frau, und dass vor allem mit Allwill der schon damals allpräsente Goethe gemeint sei. Jacobi selber verwahrte sich immer gegen die Versuche, seinen Allwill als Schlüsselroman zu lesen – mit demselben Argument übrigens, das rund 150 Jahre später noch ein Marcel Proust verwenden würde: Dass selbstverständlich seine fiktiven Personen Züge hätten von realen Personen, dass sich aber ebenso selbstverständlich in jeder seiner fiktiven Personen Züge von mehreren realen Personen mischten.
Nachdem sich der Tod der Iris abzeichnete, wechselte Jacobi für die weitere Veröffentlichung der Papiere zum Teutschen Merkur; die Fassung des Teutschen Merkurs wurde dann auch die Vorlage zur Buchfassung. Jacobi aber werkelte weiter am Text und gab 1792 die Briefsammlung heraus. Er strich ein paar der empfindsamen Passagen (immer noch zu wenige für den heutigen Geschmack!) und fügte – vor allem gegen Ende – neue Briefe ein. Mit diesen Änderungen nahm der Eduard Allwill seinen definitiven Charakter an als abermalige Auseinandersetzung mit Kant, mit dessen Kritik der Urteilskraft und dem darin (und eben auch in Goethe!) prominenten Genie-Wesen der Zeit. Hatte Goethe die Papiere noch gefördert, so trat er für die Briefsammlung in den Hintergrund, hatte er sich doch in der Zwischenzeit über den zweiten Roman Jacobis, Woldemar recht lustig gemacht. Als Förderer und Mentoren traten an seine Stelle Lichtenberg und – vor allem – Lessing.
All dies und noch mehr erfährt der Leser aus dem zweiten Teil von Band 6, dem Editorischen Bericht und den Anmerkungen der Herausgeber der kritischen Ausgabe. Wenn der Allwill als solcher – vor allem in der frühen Version – heute wenig interessiert, so macht ihn die dort vorgenommene Einbettung in die Geschichte und Soziologie der deutschen Litteratur des ausgehenden 18. Jahrhunderts zu einem faszinierenden Beispiel des Zusammen- und Gegenspiels der deutschen Intellektuellen jener Zeit.
Friedrich Heinrich Jacobi: Romane I. Eduard Allwill, Herausgegeben von Carmen Götz und Walter Jaeschke [Band 6,1 – Text] bzw. Carmen Götz [Band 6,2 – Anhang]. (= ders.: Werke. Gesamtausgabe. Herausgegeben von Klaus Hammacher und Walter Jaeschke, Band 6,1 und 6,2.) Hamburg: Meiner / Stuttgart-Bad Cannstadt: frommann-holzboog, 2006 [Text] und 2016 [Anhang]