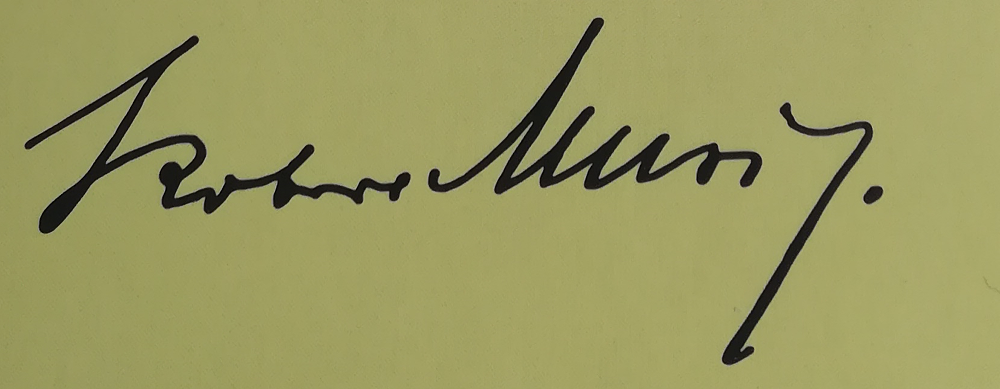Sobald ein Autor / eine Autorin ihr neuestes Werk – sei es zwischen zwei Buchdeckeln, sei es hinter einem Icon einer elektronischen Datei – der Öffentlichkeit übergeben haben, geschieht etwas Seltsames: Es beginnt, ein eigenes – nein, nicht Leben – aber eine eigene Daseinsform zu entwickeln. Es gleicht einem Brocken Lava, der getrennt vom großen Lavastrom am Rand liegen bleibt. Von nun an ist es nicht mehr Teil eines Stroms, sondern dieser Brocken, dieses Werk. Leute nehmen es auf und betrachten es. Eventuell wird es gar klassifiziert. Wenn der große Strom im Laufe der Zeit mehrere solche Brocken beiseite geworfen hat, werden diese unter Umständen gesammelt und in eine Schublade (als übergeordnete und ordnende Einheit zugleich) gesteckt – der Autor / die Autorin haben eine Werkausgabe erhalten. Doch auch innerhalb dieser Werkausgabe werden für gewöhnlich die Lavabrocken separiert gehalten. Allenfalls kreiert man in der Schublade Unterabteilungen und fasst alle Romane zusammen, alle Dramen, alle Gedichte etc. Aber auch dann bleibt unser Brocken im Geist seiner Betrachter und Betrachterinnen ein separates Werk. Selbst kritische Ausgaben, die die Genese eines Werks darstellen wollen, behalten den einen Brocken als separate Entität im Zentrum des Blicks – Vorstufen oder spätere Bearbeitungen sind wie kleine Splitter, die an den großen Brocken gehalten und mit ihm verglichen werden. Dass dieser einmal Teil eines noch größeren Stroms war, geht vergessen. Ich kenne nur zwei kritische Ausgaben, die zumindest den Versuch machen, den Zusammenhang der einzelnen Brocken mit dem Ganzen des Schaffensprozesses eines Autors, einer Autorin, zu verknüpfen. Da ist meine Hölty-Ausgabe, die verschiedene Stufen eines Gedichts als gleichwertig dem Publikum vorstellt; und da ist die so genannte Bremer Ausgabe der Werke Hölderlins, die sämtliche Werke, Briefe und Dokumente in zeitlicher Reihenfolge darzustellen bemüht ist. Natürlich sind wir als Publikum uns dessen bewusst, dass ein Autor, eine Autorin, auch von Zeit zu Zeit etwas essen und trinken müssen, dass sie verdauen und natürlicherweise auch wieder ausscheiden. Aber es öffnet einen anderen Blick auf den Hyperion, wenn ich sehe, wie Hölderlin unter der Arbeit daran immer wieder Briefe geschrieben hat an seine Susette Gontard, und wie diese Briefe so gar nicht klingen wie die Briefe Hyperions an Diotima … (Andererseits wird es dann natürlich schwieriger, wenn man den Brocken Hyperion sich separat zu Gemüte führen will, wie man es sich gewohnt ist, und nun die Teile einzeln zusammen klauben muss.)
Was hat nun diese lange Einführung mit dem vorliegenden, zweitletzten Band der Musil-Gesamtausgabe bei Jung & Jung zu tun? Nur so viel, dass hier (wie schon in den Bänden 9 und 10) die Veröffentlichungen Musils in Zeitungen und Zeitschriften chronologisch geordnet sind, und durch die so erzielte bunte Folge von Themen und Formen einen kleinen Hinweis geben auf dem Lavastrom, der im Hintergrund floss. (Natürlich weiß ich, dass ein Veröffentlichungsdatum nicht immer einen klaren Hinweis gibt auf den Zeitpunkt, an dem der Autor, die Autorin, ihr Werk definitiv abgeschlossen haben. Aber ich denke doch, dass Autor und Autorin doch zumindest kurz Notiz nehmen werden davon, wenn ein Stück veröffentlicht wird, und es damit zumindest für einen kurzen Moment in den großen Lavastrom wieder einfließt.)
Das ist aber auch schon mehr oder minder alles Positive, was ich zu diesem Band sagen kann. Wie schon die Bände 9 und 10 beruht er auf fremder Vorarbeit für eine Ausgabe, die ganz anders aufgebaut war. Somit kommen abermals Fragmente früherer Veröffentlichungen und / oder aus dem Mann ohne Eigenschaften zum Zug, die meiner Meinung nach besser im kritischen Apparat zur Hauptveröffentlichung aufgehoben gewesen wären, wenn man denn zu Beginn der Ausgabe sich schon dafür entschieden hat, die Lavabrocken in separaten Schubladen zu präsentieren. Hinweise im Nachwort auf nur geringfügige Unterschiede sind in einer Ausgabe, die mal kritisch sein wollte, fehl am Platz: Diese Unterschiede gehören aufgeführt und nicht nur angedeutet (aber die Internet-Seite, wo das mal stattfinden sollte, wird seit längerem nicht mehr weitergeführt). Dass das Publikum in einer kritischen Ausgabe seine Kritik selber durchführen soll, ist ein neues Phänomen.
Inhaltlich fällt – neben dem Recycling von Texten – wenig auf. Musil ist auch in den 1920ern und 1930ern immer noch mit dem Literaturkritiker Kerr und dem Naturalismus beschäftigt, lobt Ibsen und Hauptmann. Joyce und Proust – mit denen er einmal verglichen werden sollte – nennt er einmal, weil offenbar alle Welt sie nennt; sie scheinen ihm aber nicht wichtig zu sein. (Dafür wird der junge Hemingway lobend erwähnt.) Thomas Mann gratuliert er – recht distanziert – zum Geburtstag. Musils eigene Kritiken können auch schon mal recht satirisch ausfallen, so, wenn er die Tendenz der Gegenwartsliteratur zur Heimatdichtung bespricht. Neben den bereits bekannten Texten aus dem Mann ohne Eigenschaften (wie z.B. der Definition von Kakanien) ist ein Märchen für Kinder das Auffallendste – und, 1925 noch, zwei oder drei pazifistische Schriften. Er greift ein im Streit zwischen Rowohlt- und Fischer-Autoren, aber ohne Hintergrundinformationen (die das Nachwort nicht liefert) versteht man nicht richtig, worum es ging. Seine Versuche, eine Ästhetik des Films zu entwickeln, scheitern aus heutiger Sicht an der Tatsache, dass kurz nach dem Erscheinen seiner diesbezüglichen Artikel zuerst der Ton- und danach dann auch der Farbfilm in den Kinosälen Einzug hielten. Sie sind heute irrelevant.
Fazit für den Genussleser: Es hat Interessantes auch in Band 11. Fazit für den Berufsleser: Musil hätte Besseres verdient als diese halbgare kritische Ausgabe.