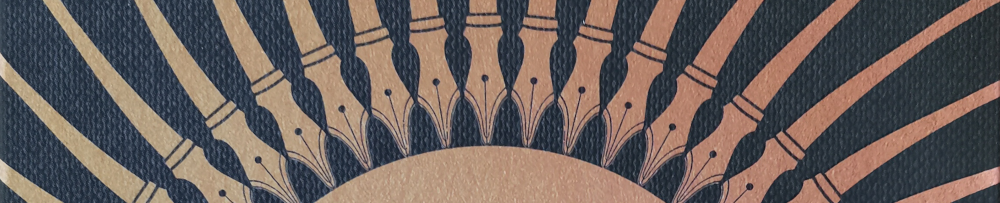Richard Ovenden hat nicht nur einen Lehrstuhl am Balliol College inne, sondern auch den Posten des Bodley’s Librarian, des Leiters der Bodleian Library, einer der berühmtesten Forschungsbibliotheken sämtlicher Hemisphären. Wenn er im vorliegenden Buch also über Bedrohte Bücher spricht, so tut dies jemand, der die Materie kennt – nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Bedrohte Bücher, der Untertitel Eine Geschichte der Zerstörung und Bewahrung des Wissens verrät es, ist eine kleine geschichtliche Abhandlung über Bibliotheken und Archive (Ovenden unterscheidet hier nicht immer strikt und spricht von Bibliothek auch dann, wenn er ein Archiv meint – allerdings dienen viele solche Institutionen auch tatsächlich in einer Doppelfunktion). Deren Entstehung, deren Unterhalt – und vor allem: deren Zerstörung.
Das fängt schon an mit dem ersten Kapitel, Rissiger Ton unter den Hügeln, in dem Ovenden die Geschichte der Bibliothek von Assurbanipal, einem berühmt-berüchtigten König der Assyrer erzählt. Über 2000 Jahre nach dem Untergang seines Reichs fanden und erforschten englische und französische Archäologen in einem politisch motivierten Wettstreit deren Überreste in ein paar riesigen Erdhügeln in der Nähe dessen, was einmal Nimrud und Ninive gewesen waren. Xenophon, der auf seiner Flucht aus Mesopotamien diese Hügel auch erblickt hatte, kannte deren geschichtlichen Hintergrund bereits nicht mehr, und so war die Überraschung und die Freude der Forscher riesig, als sie dort Abertausende von beschrifteten Tontafeln vorfanden, die sich bei der Entzifferung als eine Art Staats- und Handelsarchiv des assyrischen Reichs entpuppten. Einige waren völlig intakt erhalten, viele aber – offenbar mutwillig und mit Absicht – zerbrochen worden. Offenbar hatten die Feinde, die das assyrische Reich einnahmen, dies getan.
Damit hat Ovenden auch gleich eine der Hauptgefahren identifiziert, die den Bibliotheken drohen: Krieg bzw. der Wille des jeweiligen (oft nur temporär überlegenen) Siegers, den Beseigten mit Zerstörung ihrer Archive und Bibliotheken jegliche eigene Identität wegzunehmen, und / oder jegliche juristische Rechtfertigung für Aufenthalt und Besitz im besetzten Land, wie es zum Beispiel der später erzählte Beschuss der National Library in Washington durch die englischen Truppen während des Unabhängigkeitskriegs zeigte (der zum Glücksfall für diese National Library wurde, denn Ex-Präsident Jefferson verkaufte ihr anschließend seine eigene, bedeutend größere, besser und mit einem weiteren Blickwinkel als die National Library zusammen gestellte Bibliothek). Gleich zwei Mal wurde die Bibliothek der Universität Löwen in Belgien ausgebombt – beide Male von deutschen Truppen, im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg. Die Nationalsozialisten haben auch ohne direkte Kriegshandlungen ganze Bibliotheken zerstört – vor allem jüdische (Ovenden bringt das Beispiel von Wilna, dem heutigen Vilnius). Auch die Bibliothek von Sarajewo wurde im Jugoslawienkrieg von christlichen Bosniern beschossen, die jeden Beweis einer Existenz muslimischen Lebens in der Region auslöschen wollten. Krieg gegen Bibliotheken als Krieg gegen eine ethnische Gruppe, die nicht nur in der Realität sondern auch auf dem Papier ausgelöscht werden sollte.
(Hingegen spricht er gerade der berühmtesten Bibliothek der Antike, derjenigen von Alexandria ab, auf diese Weise zu Grunde gegangen zu sein. Weder Caesar noch der Kalif Omar können gemäß Ovenden – der sich wiederum auf Gibbon abstützt – für ihren Untergang verantwortlich gemacht werden. Sie mögen das eine oder andere Gebäude – und vielleicht wirklich aus Versehen – in Brand gesteckt haben, aber der eigentliche Untergang muss eher schleichend gekommen sein: An erster Stelle zu nennen wäre da ein selbstgerechter Stolz auf die eigene Größe und Berühmtheit, der eine Weiterentwicklung im Lauf der Jahrhunderte verhinderte. Der eine oder andere Brand eines schlecht geschützten Gebäudes mögen mitgeholfen haben, aber vor allem war es wohl die im Laufe der Zeit abnehmende finanzielle Unterstützung durch die Stadt Alexandria und weitere Mäzene. Denn im Mittelalter entstanden nun überall in Europa – vor allem in den Klöstern – eigene, lokale Bibliotheken, die auch unterstützt sein wollten, und nach und nach Alexandria zumindest in lokalem Zusammenhang den Rang abliefen. Die von Alexandria verschwand so im Orkus der Zeitläufte.)
Eine Spezialform der Zerstörung durch Krieg ist die Auflösung und Vernichtung vieler Klosterbibliotheken im Zug der Reformation – vor allem in England (Ovenden bringt natürlich viele englische Beispiele bei). Ihre Bestände, soweit sie nicht ganz zerstört wurden, wurden über das ganze Land, ja ganz Europa, verteilt. Viele aus heutiger Sicht unersetzliche Kulturschätze wurden vernichtet. Dass sich unter den Verantwortlichen auch irre geleitete Humanisten befanden, betrauert Ovenden natürlich besonders.
Dass auch BibliothekarInnen selber eine Quelle von Zerstörung sind, streift Ovenden dann nur am Rand. Aber dass es ein wichtiger Teil ihrer Aufgaben ist, nicht nur immer Neues zu archivieren, sondern auch das Alte zusehends auszudünnen, weil die Wichtigkeit von Dokumenten im Lauf der Zeit abnimmt oder ganz einfach kein Platz mehr für alles vorhanden ist, erwähnt auch er und spricht dabei vom Kuratieren. (Etwas, das ja selbst kleine Besitzer kleiner Privatbibliotheken wie ich kennen. Ich werde in Zukunft als Berufsbezeichnung demnach nur noch „Kurator einer Privatbibliothek“ in entsprechende Formulare setzen.)
Last but not least bespricht Ovenden auch das Problem der Nachlässe berühmter Persönlichkeiten – allen voran von SchriftstellerInnen. Er akzeptiert fraglos, dass es einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin unbenommen bleibt, ihren eigenen Nachlass zu kuratieren, wie er es nennt. Anders gesagt: Natürlich dürfen sie Briefe oder Manuskripte, die ihnen peinlich sind, verbrennen oder in den Mülleimer kippen. Problematisch wird es mit den AutorInnen, die in einer wie auch immer gearteten Verfügung ihre Nachfahren mit dieser Zerstörung beauftragen. Bei Byron waren das Freunde, die aus eigenem Antrieb sehr viel Material zerstört haben, das wohl sie selber in schlechtem Licht zeigte. Ähnlich ging der ihr zum Zeitpunkt ihres Todes schon längst entfremdete Mann Sylvia Plaths vor. Auch Philip Larkins Erbinnen taten mit intimen Briefen dasselbe. Natürlich erwähnt Ovenden auch das Gegenbeispiel: Max Brod, der entgegen Kafkas Anordnungen dessen Manuskripte nicht zerstörte, sondern zum Druck beförderte. Ihm verdankt Franz Kafka seinen zumindest postumen Ruhm als Schriftsteller von Weltrang, denn was er selber noch veröffentlicht hatte, war kaum der Rede wert.
Zum Schluss kommt Ovenden dann auf das Problem der Digitalisierung zu sprechen – will sagen, all der Informationen, die heute im Internet gepostet werden. Dabei denkt er nicht nur an über ‚offizielle‘ URLs erreichbare Seiten sondern vor allem auch an das, was in den so genannten ‚Social Media‘ gepostet wird, und da wiederum hauptsächlich an das, was dort wieder gelöscht wird, womit nicht nur Spuren verbrecherischer Tätigkeit verschwinden, sondern oft auch Stellungnahmen bekannter Menschen – Ovenden bringt, natürlich, das Beispiel von Donald Trump. Bei der Beantwortung der Frage allerdings, wie das alles gespeichert werden soll, bleibt Ovenden im Vagen. Er verlangt Maßnahmen wie eine Besteuerung aller großen Internetkonzerne, die aktuell als einzige, dafür aber in riesigem Ausmaß Daten speichern (was er aus mehreren Gründen für gefährlich hält), aber wie das möglich sein soll, darüber äußert er sich nicht. (Selbst in der kleinen Schweiz, wo jeder Kanton seine eigenen Steuergesetze erlässt, ist es nicht möglich, dass sich die 26 Kantone nicht in ständigem Wettstreit um den steuertechnisch günstigsten Standort befinden!)
Last but not least der Aufruf, dass die öffentliche Hand endlich damit aufhören soll, den Bibliotheken immer mehr finanzielle Mittel zu entziehen, da sie so zusehends weniger lebensfähig werden. Ovenden aber hält, bei aller Fragilität, die ihnen eigen ist, öffentliche Bibliotheken immer noch für die einzig gute Lösung der Frage der Archivierung und Zur-Verfügung-Stellung (!) von Daten.
Alles in allem ein Fachbuch, wie ich mir es vorstelle: Interessant geschrieben, informativ, sauber dokumentiert (es gibt einen Anhang von Endnoten, in denen nicht nur die Stellennachweise der Zitate stehen, sondern auch noch weitere Quellen zitiert werden) und mit einer Liste weiterführender Literatur versehen.
Richard Ovenden: Bedrohte Bücher. Eine Geschichte der Zerstörung und Bewahrung des Wissens. Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff. Berlin: Suhrkamp, 2021.
[Der deutsche Titel ist meiner Meinung nach ein bisschen schönfärberisch und kaschiert Ovendens Intentionen. Im Original von 2020 lautet der Titel Burning the Books. A History of Knowledge under Attack, die Lage ist also für den Autor viel dramatischer und er ist bedeutend weniger optimistisch, was die Zukunft von Bibliotheken und Archiven betrifft, als das hinzugefügte Wort Bewahrung des deutschen Untertitels suggeriert. Nicht umsonst wird vor allem im zweiten Teil immer wieder aus George Orwells 1984 zitiert. Auch will man offenbar in Deutschland nicht so gern ans Verbrennen von Büchern erinnert werden, und sieht die Lage lieber etwas rosiger. Doch Ovenden beginnt sein Buch nicht umsonst mit dem berühmten Zitat aus Heinrich Heines Almansor:
Das war ein Vorspiel nur, dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.
Und wenn man die Seite umdreht, auf der das Heine-Zitat als Motto steht, finden wir als erste Illustration des Buchs eine Fotografie von der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 in Berlin, als sich eine nationalsozialistische Studentenorganisation damit bei Göring einzuschleimen dachte.]