Salomon Gessner (1730-1788) war zu Lebzeiten ein bekannter Autor und Maler. Doch schon bald nach seinem Tod versank er mit beiden seiner Talente in der Vergessenheit. Vor mir liegt eine Auswahlausgabe seiner schriftstellerischen Werke, 1973 bei Georg Olms erschienen, aber ihrerseits ein Reprint einer älteren Ausgabe, nämlich einer in der Reihe Deutsche National-Litteratur bei Spemann erschienenen. Die Reihe trägt als Untertitel die Bezeichnung Historisch kritische Ausgabe. Das gilt vielleicht für andere Bände der Reihe, in Gessners Werken fehlt jedweder kritische Apparat. Der Herausgeber der Reihe war der umtriebige Joseph Kürschner, der des ursprünglich 1884 erschienenen Bandes 41 war ein gewisser Prof. Dr. Ad. Frey. Adolf Frey war Professor für deutsche Literatur an der Universität Zürich und damals für die Schweizer Literatur, was ihr heute Peter von Matt ist – Kenner, Förderer, Propagandist. Wie klein allerdings schon 1973 die Nachfrage nach Salomon Gessner gewesen sein muss, zeigt der Umstand, dass ich dieses Buch zwar antiquarisch erstanden habe, es aber noch in der Original-Folie verschweißt war, mit der es hätte an den Buchhandel ausgeliefert werden sollen. Entweder hat also der Vorbesitzer das Buch nie gelesen, oder es landete direkt vom Verlag im Antiquariat.
Dass der Schriftsteller Gessner schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts praktisch vergessen war, liegt an der speziellen Wahl seiner Motive. Er war sozusagen spezialisiert auf (und bekannt für) seine Idyllen, kurze Texte in anakreontischer Manier, die von Liebeshändeln und Liebesglück handeln in einer nur oberflächlich skizzierten, offenbar dem antiken Griechenland nachempfundenen Landschaft unter Schäfer und Schäferinnen (auch sie alle mit griechischen Namen versehen). Diese Schäfer und Schäferinnen haben nicht viel anderes zu tun, als sich mit ihren Liebesgeschichten zu beschäftigen. Dass sie Schafe oder Ziegen hüten, wird bestenfalls nebenbei erwähnt. Ihre Haupttätigkeit ist das Schnitzen von Flöten und anschließende darauf Spielen, das Ersinnen von Liedern und das Singen derselben. Wettbewerbe unter ihnen drehen sich darum, wer am besten schnitzt oder spielt, dichtet und komponiert bzw. singt. Alle sind schön und alle sind äußerst tugendhaft. Schon diese Beschreibung genügt wohl, um anzudeuten, warum diese Literaturgattung mit Gessner ausgestorben ist, bzw. allenfalls noch als Parodie ausgeübt wird, wie z.B. bei Arno Holz.
Dennoch hat Adolf Frey nicht Unrecht, wenn er Gessner in eine Reihe stellt mit den späteren Goethe, Herder oder Schiller – vom gleichzeitigen Wieland ganz abgesehen, den Gessern persönlich kennen lernte, als sich dieser in Zürich aufhielt. Obwohl Gessner in einem ganz ähnlichen Stil schrieb wie später Wieland ist allerdings diesbezüglich wohl keine Beeinflussung gegeben – der Wieland der Zürcher Zeit war im Denken und Schreiben noch weit von seinen ganz großen Werken entfernt. Auch zum Sturm und Drang will Frey durchaus Verbindungen sehen. Zwar hat Schiller später, in seiner ästhetischen Grundlagenschrift Über naive und sentimentalische Dichtung Gessner als minderen Vertreter der sentimentalischen Richtung abgetan. Und doch muss ich Frey Recht geben. Zwar wirken Gessner Idyllen alles andere als revolutionär. Obwohl Gessner als seine antiken Vorbilder Anakreon und Theokrit angibt, so sind diese es doch nur mittelbar. Gessner konnte kein Altgriechisch und lernte diese antiken Autoren durch französische Übersetzungen kennen, die von französischen Hofpoeten erstellt worden waren. Ein durchaus konservativer, ja reaktionärer Hintergrund also. Dennoch haben Gessners Idyllen in französischer Übersetzung noch Diderot und Rousseau erreicht und beeinflusst. Und auch ein Seume, dem wir kaum Sympathien zu den damaligen Höfen nachsagen können, hat seinen Spaziergang nach Syrakus unternommen, um Theokrit in seiner Heimat lesen zu können und um auf dem Rückweg einen Umweg über Zürich zu machen, weil er dort – nicht Gessner, der war schon verstorben – aber doch seine Witwe besuchen wollte. Diderot, Rousseau und Seume mögen sich dessen nur unbestimmt bewusst gewesen sein, aber Gessners Idyllen sind tatsächlich nur oberflächlich harmlos und systembewahrend. In Tat und Wahrheit steckt darin ein gehöriges Maß an subversivem Denken. Wie auf seine Art der Sturm und Drang, so war auch Gessner in seinen Idyllen auf der Suche nach Freiheit. Mit wenigen Ausnahmen, und die sind alle in der zweiten, viel später erschienenen Folge zu finden, sind die Schäfer und Schäferinnen in Gessners Idyllen frei von jeder Obrigkeit. Ihre Arbeit ist kaum eine solche zu nennen. Sie leben ein Leben, wie es sich ziemlich genau 200 Jahre später die Hippies wieder erträumen würden. Es ist eine gesellschaftliche Utopie, die Gessner hier zeichnet. Die Spitze ist ihr nur oberflächlich dadurch genommen, dass dieses Utopia in der Vergangenheit angesiedelt ist – allerdings dies nicht einmal explizit, wir schließen es nur daraus, dass Gessner hier alten Traditionen folgt. Und wo, wie in der zweiten Folge, dann tatsächlich einmal eine gesellschaftliche Hierarchie angedeutet wird (die Schäferin arbeitet für einen Mann, der offenbar seinerseits bei einem Reichen angestellt ist), und sogar der Missbrauch der Macht, zu dem diese Hierarchie den reichen Mann treibt (er sieht auf einer Inspektionsreise die schöne Schäferin und will sie erst verführen, als er abblitzt gar vergewaltigen), ist nur ein temporärer. Die Schäferin kann gerade noch entkommen und flüchtet zum Grab ihrer Mutter, der sie völlig aufgelöst alles erzählt und um deren Schutz sie bittet. Der Vergewaltiger, der ihr gefolgt ist, hört ihr hinter einem Busch versteckt zu. Die Tugend der jungen Frau weckt auch in ihm die Tugend, er kommt hervor und bittet die Schäferin um Verzeihung. Man sieht: Die so stark betonte Tugendhaftigkeit des Personals dieser Idyllen verfolgt einen bestimmten Zweck. Nur weil alle von sich aus tugendhaft denken und handeln, kann diese Utopie aufrecht erhalten werden. Darin nun gleicht Gessners Utopie derjenigen von Rabelais – bei aller Verschiedenheit der Absichten und Einrichtungen, funktioniert auch Rabelais‘ Thelema im Buch Gargantua mit ihrem Motto „Tu, was dir gefällt!“ nur, weil die Tugend und Aufgeklärtheit der BewohnerInnen der Abtei jeden Missbrauch dieses Mottos von Anfang an verhindert. Nur deshalb ist es bei Gessner auch möglich, dass schon mal ein Schäferin mit aufgelösten Haar und offenem Mieder bei ihrem Geliebten erscheint, ohne dass der nackte Busen bei diesem dann andere Gefühle erweckt als Eifersucht auf den, der seiner Geliebten das Mieder öffnen durfte. (Es war, wie sich herausstellen sollte, der kleine Nachbarsjunge im Spiel.) Nur so ist es dann auch möglich, dass auch schon mal zwei Schäferinnen zusammen nackig baden gehen und sich im See ihre intimsten Liebesgeheimnisse verraten. Als sich in der realen Geschichte die Hoffnung auf diese Tugend zerschlagen hatte, war es auch mit der Beliebtheit dieser Idyllen vorbei. Was die deutsche Literatur betrifft, so sind nicht zuletzt Die Leiden des jungen Werthers deren Totengräber gewesen, wo das Idyll um Lotte durch den jungen Werther empfindlich gestört wird – mit schlimmen Folgen für diesen. Das anakreontische Idyll hatte den Realitätstest für Goethe nicht bestanden und wurde preis gegeben.
Kommen wir noch zum übrigen Inhalt der Werkausgabe vor mir (ich werde hier nicht alles erwähnen):
Nach einer Einleitung und einem kurzen Prosa-Stück mit dem Titel Die Nacht folgt das erste bekanntere Stück: Daphnis. Es handelt sich um eine Art Schäferroman, in loser Anlehnung an Daphnis und Chloë des byzantinischen Autors Longos. Im Grunde genommen eine erweiterte Idylle, und was ich oben dazu geschrieben habe, gilt auch hier.
Interessanter hingegen ist der nächste größere Roman, Der Tod Abels. Frey will nicht sehr viel an ihm entdecken, und … nun ja: So ganz kann sich Gessner nicht von seinem idyllischen Setting trennen. Alle auftretenden Figuren sind die Tugendhaftigkeit in Person – außer Kain, der ein schlechtgelaunter Miesepeter ist. Spannung kann in diesem Roman auch keine aufkommen – wir alle wissen aus dem Buch Genesis des Alten Testaments, wie die Geschichte ausgeht. Dennoch finden wir hier zwei interessante Momente. Gessner sind sie wohl selber nicht bewusst gewesen, denn er versaut sie sich beide wieder sehr rasch. Da kommt zunächst einmal ein Moment, als Adam schwer erkrankt. Er liegt auf seinem Lager und fürchtet zu sterben. Da packt ihn das Grauen, denn – offen gesagt – sein Leben und das seiner Familie war bisher trotz der Vertreibung aus dem Paradies ein sehr anakreontisch-idyllisches. Nun aber greift der völlig fremdartige Tod ein und Adam spürt zum ersten Mal wirklich, was es heißt, aus dem Paradies vertrieben zu sein. (Er erholt sich wieder und vergisst offenbar alles aus dieser Nacht. Seine Erkrankung war von Gessner nur eingeführt worden, um Abel zu zeigen, der auf Geheiß eines Engels die heilenden Pflanzen nach Hause bringt, worauf natürlich Kains Eifersucht noch weiter steigt.) Dann ist da der Punkt, an dem die Geschichte definitiv dreht. Der schmollende Kain wird von einem – Teufel gesehen. Der wittert nun seine Chance. Denn auch dieser kleine Teufel ist eifersüchtig, eifersüchtig nämlich auf den großen Satan, der mit seinem Erfolg als Schlange bei Eva in der Hölle riesigen Applaus gefunden hatte. (Gessner kannte zweifelsohne Miltons Epos und dichtete hier eine Art Fortsetzung.) Leider lässt der Autor auch dieses Thema wieder fallen. Als Kain dann Abel tatsächlich erschlagen hat, wird der Teufel auf himmlischen Befehl – vom Teufel geholt. Schade um das schöne Motiv – in beiden Fällen.
Am Schluss der Werkausgabe befindet sich dann noch der damals recht bekannte Brief über die Landschaftsmalerei an Herrn Fueßlin, den Verfasser der Geschichte der besten Künstler in der Schweiz. Gessner war ja in der Malerei keineswegs der Dilettant, als den ihn Wikipedia verschreit. Er war Autodidakt, das ja. Und in diesem Brief beschreibt er, wie er sich de facto selber das Malen von Landschaften beigebracht hat – nämlich, indem er wieder und wieder die Werke seiner Vorbilder, allen voran von Poussin und von Lorrain, kopiert, die Art und Weise studiert und imitiert, wie sie zum Beispiel das Astwerk eines Baumes zeichneten. Gessners Brief ist vor allem wegen dieser Schilderungen interessant; immerhin verdiente der Autodidakt sein Leben lange Zeit als Aquarellist (Malerei in Öl gelang ihm weniger) und, wie wir heute sagen würden, als Gebrauchsgraphiker. Die vom Vater ererbte Buchhandlung wurde in Tat und Wahrheit von seiner Frau geführt, die selber aus einer Buchhändlerfamilie stammte und wahrscheinlich geschäftstüchtiger war als ihr Mann. Dieser hingegen entwarf eine Reihen von Landschaftsmotiven für die damalige Züricher Porzellanmanufaktur – etwas, das noch Gottfried Keller wusste, und worauf er in einer seiner Züricher Novellen anspielt.
Summa summarum: Zwei oder drei kleine Perlen in einem Meer von Tand, aber von gut gemachtem Tand. Gessner hatte das Pech, sehr rasch vom nachfolgenden Sturm und Drang und dann der Deutschen Klassik verdrängt worden zu sein. Darunter leidet noch heute sein Ruf – ähnlich, wie der des Mittelalters noch heute darunter leidet, von den Humanisten und der Renaissance als „dunkel“ verschrien worden zu sein. Man könnte ihn durchaus wieder lesen, wie ich finde (und das sage ich nicht aus Lokalpatriotismus).

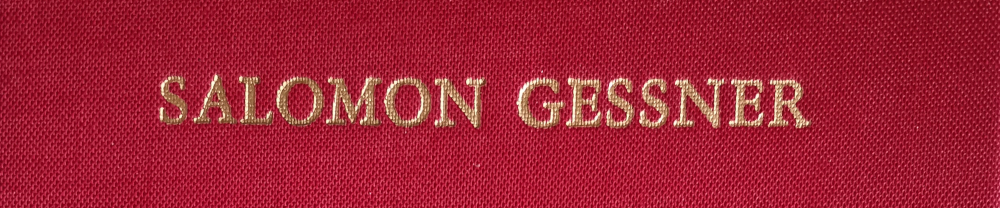
Erinnerlich ist mir der programmatisch emphatische Ausruf des jugendlichen Schäfers: „Schnäbeln, schnäbeln!“ Im Nachwort stand auch, dass Diderot diese Idyllen hübsch fand. Noch passender gewesen wäre das bei Marie-Antoinette und ihrem Gefolge, die mit rosa Seidenschleifen geschmückte Schäfchen durch den Hameau führten. Ob dann echte Schäfer eher revolutionär oder reaktionär gesinnt waren, ist mir nicht bekannt.