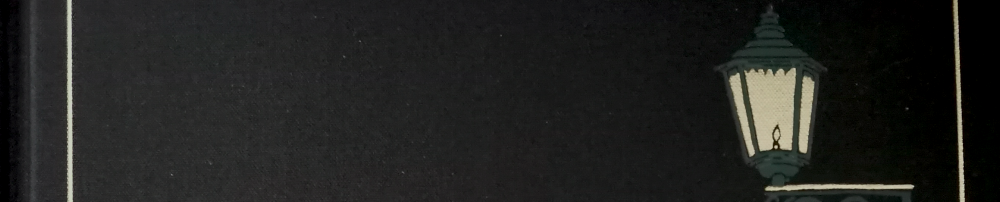Habe ich doch in meinen Regalen noch einen Band mit Kurzgeschichten von Robert Louis Stevenson gefunden … (Gut, ich gebe zu: Es war keine Überraschung. Ich wusste, dass ich zwei solche Bücher besitze, sie stehen ja auch im Regal nebeneinander. Sie sind sogar als Pärchen erschienen, 2007 bei der Folio Society in London, und weisen eine identische Aufmachung aus. Der Inhalt ist natürlich ein anderer, wenn auch die Sammlungen, denen er zumindest teilweise entnommen ist, immer die gleichen sind – Stevenson hat zu Lebzeiten nur deren drei veröffentlicht.) Hier also, was wir in diesem Buch vor uns haben:
• Aus: New Arabian Nights [in etwa: Neue Geschichten aus Tausendundeiner Nacht]:
◦ A Lodging for the Night [Ein Nachtquartier]
◦ The Sire de Malétroit’s Door [Die Tür des Sire de Malétroit]
◦ The Suicide Club [Der Selbstmörderclub]
▪ Story of the Young Man with the Cream Tarts [Die Geschichte von dem jungen Mann mit dem Cremetörtchen]
▪ Story of the Physician and the Saratoga Trunk [Die Geschichte von dem Arzt und dem Saratogakoffer]
▪ The Adventure of the Hansom Cabs [Das Abenteuer mit den zweirädrigen Kutschen]
◦ The Rjah’s Diamond [Der Diamant des Radschas]
▪ Story of the Bandbox [Die Geschichte von der Hutschachtel]
▪ Story of the Young Man in Holy Orders [Die Geschichte von dem jungen Geistlichen]
▪ Story of the House with the Green Blinds [Die Geschichte des Hauses mit den grünen Jalousien]
▪ The Adventure of Prince Florizel and a Detective [Die Abenteuer des Prinzen mit dem Kriminalbeamten]
• Aus: The Merry Men and other Tales and Fables [Die tollen Männer und andere Erzählungen]
◦ The Treasure of Franchard [Der Schatz von Franchard]
◦ Markheim
• Aus: Island Nights’ Entertainments [Unterhaltungen in Inselnächten]
◦ The Beach of Falesá [Der Strand von Falesá]
• Uncollected Stories [nicht aus Sammlungen]
◦ The Story of a Lie [Die Geschichte einer Lüge]
◦ The Body-Snatcher [Der Leichenräuber]Zu letzterem eine Anmerkung:
Die deutschsprachige Wikipedia führt The Body-Snatcher als Teil der Sammlung New Arabian Nights, mit den Publikationsjahren 1884 für die Erzählung, 1882 für die Sammlung, was ein bisschen seltsam ist. Ich halte mich deshalb an meine Ausgabe, die The Body-Snatcher als zu Stevensons Lebzeiten unveröffentlicht ausweist. Die englischsprachige Wikipedia kennt denn auch eine Veröffentlichung in einer Sammelausgabe erst postum, 1905 in Tales and Fantasies, was einleuchtender klingt.
Wie schon im Bruderband The Isle of Voices sind natürlich auch hier Geschichten von unterschiedlichem Wert versammelt, auch wenn (wie dort) keine ganz abfällt und es manchmal vielleicht auch nur Geschmackssache ist, ob man eine Erzählung nun mag oder nicht.
A Lodging for the Night erzählt die Geschichte einer Nacht des französischen Poeten und Theologen François Villon. Stevenson soll zur Zeit der Abfassung des Textes gesagt haben, dass dieser Villon, wie er ihn schildert, eine Karikatur seiner selbst sei. Wie er das genau gemeint hat, weiß ich leider nicht. Villon ist in dieser Geschichte ein geschickter Disputant, aber auch einer, der stiehlt, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Schön und lesenswert ist vor allem der erste Abschnitt der Erzählung, in der Stevenson den nächtlichen Schneefall im mittelalterlichen Paris schildert. Da zeigt diese ansonsten schlecht konstruierte Geschichte die Qualitäten, mit denen der spätere Stevenson brillieren sollte.
In The Sire de Malétroit’s Door finden wir eine ebenfalls im Mittelalter angesiedelte Liebesgeschichte, die als Horror beginnt und lieblich endet. Zwei oder drei Überraschungen sind versteckt, aber das Ganze ist nichts Besonderes. (Auch wenn es natürlich Autoren gäbe, die froh sein dürften, diese Geschichte geschrieben zu haben: Stevenson kann es besser.)
The Suicide Club besteht seinerseits aus drei lose zusammenhängenden Geschichten. Der Zusammenhang wird vor allem durch die drei Protagonisten erstellt: Florizel, den Prinzen von Böhmen, seinen Sidekick Colonel Geraldine und den Bösewicht in Gestalt des (später: ehemaligen) Präsidenten des Selbstmörderclubs. Daneben kennt jede Geschichte einen weiteren Hauptdarsteller, einen Außenseiter, der sozusagen durch die Story führt, weil sie aus seiner Sicht und mit seinem Wissen geschildert wird. Am Ende einer jeden Story wird dieser Außenseiter einem persönlichen Happy Ending zugeführt und so aus der Geschichte herausgeschrieben. Typisch ist jedes Mal eine Formulierung in folgenden Stil:
Here says my Arabian author ends ‘THE STORY OF THE YOUNG MAN WITH THE CREAM TARTS’, who ist now a comfortable householder in Wigmore Street, Cavendish Square. […] Those who care to pursue the adventures of Prince Florizel and the President of the Suicide Club, may read the ‘HISTORY OF THE PHYSICIAN AND THE SARATOGA TRUNK’.
Was dann auch gleich die nächste Geschichte ist.
Stevenson parodiert hier die Kriminalgeschichten um Lecoq, die Émile Gaboriau veröffentlicht hatte. Ein gewisser Arthur Conan Doyle hat ein Jahrzehnt später (neben Gaboriau selber natürlich) offenbar Stevensons Parodie gelesen – die Idee des in allen möglichen Kampfkünsten bewanderten und hochintelligenten Prinzen und eines Sidekicks kommt einem jedenfalls bekannt vor.
Die zweite Sammlung in der Sammlung, The Rjah’s Diamond funktioniert nach demselben Prinzip. Auch hier ist Prinz Florizel der Protagonist, dieses Mal allerdings ohne Sidekick. Auch hier haben wir junge Männer, die seltsame Dinge erleben und aus deren Sicht die einzelnen ‚Untergeschichten‘ jeweils erzählt werden (NB: Es handelt sich aber nicht um Ich-Erzählungen!). Im Zentrum steht der Diamant eines indischen Radschas, der einem ehemaligen englischen Beamten der englischen Verwaltung geschenkt wurde, und der nun als eine Art Agent des Bösen Mann um Mann zu Diebstahl und Mord verlockt. Selbst ein Geistlicher ist nicht vor dem negativen Einfluss des Steins gefeit. Zum Schluss ist er in Besitz des Prinzen, der entsetzt merkt, dass auch er den Stein im Grunde genommen gestohlen hat, auch er also dessen Einfluss unterlegen ist. Er wirft den Stein in die Seine. Dies ist die letzte Geschichte der .Untersammlung’ The Rjah’s Diamond. Sie endet demgemäß auch ein bisschen anders als alle anderen. Zunächst nämlich will der Erzähler seinen Prinzen topsy-turfy into space schicken, zusammen mit dem Arabian Author, den er nun auch nicht mehr braucht. Dann beschließt er aber zumindest für den Prinzen ein anderes Ende. Er wird, weil er ja nie zu Hause war und regiert hat, in einer Revolution vom böhmischen Thron gestoßen und verliert dabei sein gesamtes Vermögen. Nun führt er ein kleines Tabakwaren-Geschäft in London und sitzt mit dem Flair eines olympischen Gottes hinter dessen Theke – auch wenn das nunmehrige sesshafte Leben sich langsam auf seiner Taille abzuzeichnen beginnt …
Vor allem die kleinen metatextlichen Scherze machen die beiden Sammlungen um den Prinzen von Böhmen lesenswert.
The Treasure of Franchard hingegen ist eine erbauliche Geschichte um einen Arzt in der französischen Provinz, der dort den lieben Gott einen guten Mann sein lässt und anstatt zu praktizieren lieber in der Gegend botanisiert. Er lebte einst in Paris, hat aber dort immer nur sein Geld am falschen Ort eingesetzt, so im Glücksspiel. Als er nunmehr sogar aus der Provinz sein letztes Geld an der Börse verspekuliert hat, wird er in extremis von seinem Adoptivsohn vor dem Ruin gerettet. Lieblich und nett.
Mehr Tiefgang hat die folgende Geschichte, Markheim, auch wenn sie nicht ganz logisch durchkonstruiert ist. Markheim ist ein junger Mann, der das von seinem Onkel geerbte Geld mit Frauen und Glücksspiel durchgebracht hat. In seiner Not ersticht er den Pfandleiher, bei dem er nach und nach die Schätze des Onkels versetzt hat. Als er das Haus nach dessen Geld absucht, findet sich eine weitere Gestalt ein. Ihr Aussehen variiert, manchmal sieht sie aus wie ein Spiegelbild Markheims. Sie agiert als Versucher: Zunächst verspricht sie – gegen Beteiligung – Markheim zu verraten, wo der Pfandleiher sein Geld versteckt hat. Als dann das Dienstmädchen vom Ausgang heimkehrt, gibt er ihm Ratschläge, wie er der Gefahr des Entdeckt-Werdens am besten entrinnt – nämlich, indem er das Mädchen auch noch umbringt. Doch Markheim reagiert anders:
If my love of good is damned to barreness; it may, and let it be! But I still habe my hatred of evil; and from that, to your galling disappointment, you shall see that I can draw both energy and courage.
schreit er seinen Versucher an. Dieser aber ändert sein Aussehen abermals; sein Gesicht beginnt in sanftem Triumph zu strahlen. Also doch nicht der Teufel? Man hat in der Sekundärliteratur von einem Schutzengel gesprochen, aber mir will scheinen, dass dieser etwas spät auf dem Schauplatz erscheint.
Den Strand von Falesá habe ich hier schon vor vier Jahren vorgestellt. Ich verweise also auf jene Besprechung dieser späten Geschichte, in der Stevenson nicht nur von seinen romantischen Anfängen wegkommt und zu einem Realismus findet, der mit Kritik am Kolonialismus und an der Ausbeutung der einheimischen Frauen in der Südsee nicht spart.
Die Geschichte einer Lüge ist abermals eine ungeheuer verwickelt aufgezogene Liebesgeschichte mit Happy Ending.
Mehr Interesse verdient die letzte Erzählung meiner Auswahlausgabe – die Geschichte, die auch dem Buch seinen Titel gegeben hat: The Body-Snatcher. Sie spielt in Edinburgh und basiert auf einer wahren Geschichte, die sich dort zugetragen hat. Die Universität Edinburgh war im 19. Jahrhundert für ihre Vorlesungen und Praktika in Anatomie berühmt. Das führte zu einem großen Andrang von Studenten – was wiederum dazu führte, dass zu wenig Leichen zur Verfügung gestellt wurden. Der dortige Professor Robert Knox (der hier von Stevenson nur als K––– geführt wird) ließ sich verleiten, Leichenräuber in Dienst zu nehmen, die illegal frische Gräber öffnen sollten. Da auch so der Nachschub nicht so richtig klappen wollte, beschlossen offenbar zwei seiner ‚Lieferanten‘, dem Geschäft ein wenig nachzuhelfen und auch schon mal jemand umzubringen. Aus den im richtigen Leben William Burke and William Hare heißenden Männern, die keineswegs der medizinischen Profession angehörten, machte Stevenson zwei junge Ärzte oder angehende Ärzte, die im Auftrag des Professors K––– die Leichen entgegen nahmen und die Lieferanten bezahlten. Hier ist es dann auch der eine der beiden jungen Ärzte, der einen Mord begeht. Eines Nachts nun (es ist finster und es regnet in Strömen – eine typische romantische Schauernacht also) machen sich die beiden jungen Männer persönlich auf, die Leiche einer Bäuerin im Nachbardorf zu exhumieren. Auf dem Heimweg merken sie, dass sich die Leiche in ihrem Sack merkwürdig verändert hat. Sie öffnen den Sack und finden den Körper eines gewissen Gray, eines Mannes, den sie schon langen seziert glaubten und den Macfarlane, der ältere der beiden, persönlich umgebracht hatte, weil er zu viel wusste. Als Horrorgeschichte nicht übel gelungen, auch wenn – wie es wohl bei solchen Stories sein muss – interne Verknüpfungen der Ereignisse fehlen oder zumindest fehlerhaft sind.
Alles in allem aber gilt auch für diese Geschichten: Stevenson kann erzählen und lohnt die Lektüre allemal.