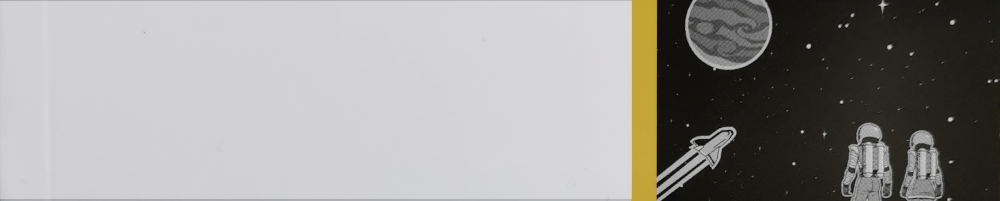1979 gegründet, war der Junius Verlag ursprünglich das Organ einer marxistischen Kleinpartei in Deutschland, das die Welt aus trotzkistischer Sicht erklärte. Dazu diente offenbar auch die 1984 von einem anderen Verlag übernommene Reihe „zur Einführung“. Der Verlag (und mit ihm die Reihe) hat seither eine ideologische Öffnung erfahren, ist aber wohl immer noch auf der linken Seite des politischen Spektrums der BRD anzusiedeln. Ein Beispiel einer solchen Öffnung haben wir mit dem vorliegenden Band der Reihe „zur Einführung“ vor uns.
Darin versucht Isabella Hermann an Hand vieler Beispiele dem Publikum das Phänomen der Science Fiction näher zu bringen. Nach einer Einleitung zu Definitionsfragen und einer wissenschaftlichen Verortung der Science Fiction widmet sie sich einer Erläuterung am Beispiel von drei aktuell dominierenden Themen der Science Fiction (die sie übrigens, anders als wir hier, immer Science-Fiction mit einem Bindestrich schreibt, was im Deutschen korrekter ist, im internationalen Vergleich aber keinen Sinn macht).
Die Einleitung besteht in einem kurzen Abriss der Entstehung dessen, was wir heute ‚Science Fiction‘ nennen – beginnend natürlich bei Mary Shelleys Frankenstein, weiter gehend über Wells und Verne, die US-amerikanische ‚Pulp Fiction‘ (Campbell, Astounding) und dem goldenen Zeitalter der US-amerikanischen Science Fiction mit Asimov, Clarke und Heinlein (wobei Clarke eigentlich ja nicht US-Amerikaner war), um sich dann für die Gegenwart vor allem den Filmen zu widmen. (Dass politische Utopien und Dystopien oft in Form von so genannten ‚Zukunftsromanen‘ präsentiert werden, ist für Hermann insofern wichtig, als sie das Bindeglied darstellen zur ‚unpolitischen‘ Science Fiction, die nach ihr halt eben doch mehr oder weniger politisch argumentiert.)
Die drei Themen sind Roboter und künstliche Intelligenz, Die Eroberung des Weltraums und Klimawandel und Umweltkatastrophen, denen sie an Hand von Beispielen der Literatur nachgeht und vor allem von Filmen (die Alien-Franchise oder 2001 Odyssee im Weltraum) und TV-Serien (Star Trek natürlich, aber auch die Raumpatrouille wird erwähnt), wobei die Autorin die eigentliche ‚Science‘, also die naturwissenschaftliche Basis vieler Storys aus diesem Bereich, völlig weglässt. Ob dieser Vorauswahl statistische Erhebungen zu Grunde gelegt sind, oder einfach der persönlichen Sicht der Autorin entsprechen, konnte ich nicht herausfinden. (Was durchaus daran liegen kann, dass ich den einen entscheidenden Satz dazu überlesen habe.) Ich will die Behandlung der drei Themen hier auch nicht nachvollziehen oder zusammenfassen und (mit ein paar Ausnahmen) die Kenntnisse in oder die Präsentation von Science Fiction der Autorin kritisieren. Sie weiß und kennt viel mehr als ich, vor allem im Bereich von Film und Fernsehen, auf den sie große Teile ihrer Interpretationen stützt.
Ein Grund für meine Zurückhaltung ist, dass ich nicht sicher bin, wer denn nun das mit diesem Buch anvisierte Zielpublikum ist. Fleißige Lesende von Science Fiction werden den Beispielen der Autorin ohne Probleme weitere Beispiele hinzufügen können – und auch Gegenbeispiele finden. Diese Lesenden können also nicht gemeint sein, so wenig wie fleißige Konsument:innen entsprechender Filme und TV-Serien. Als eine Einführung in die Theorie der Science Fiction ist das Buch insofern ungeeignet, als die theoretischen Schriften der behandelten Autoren allesamt fehlen – allen voran scheint Hermann außer Solaris wenig bis gar nichts von Stanisław Lem zu kennen. Am ehesten könnte ich mir diese rund 200 Seiten vorstellen als Begleitheft in einem gymnasialen Leistungskurs in Literatur zum Thema ‚Science Fiction‘ (wenn es so etwas gibt). Dazu passt neben der Tatsache, dass vor allem anerkannte Klassiker von Literatur und Kino vorgestellt werden und der Umstand, dass bei jedem vorgestellten Buch oder Film eine relativ eindeutige (und deshalb halt dann oft: vereinfachte und vereinfachende) Interpretation gegeben wird.
Das Ganze ist last but not least kopflastig (wie man so schön sagt)– da hilft auch der letzte Satz des Buchs nicht mehr: Die Science-Fiction vermag beim Nachdenken zugleich wunderbar zu unterhalten. Darüber, über das Unterhalten, hätte ich gern mehr gelesen. Das wird im ganzen Buch praktisch ausgeblendet, eben auch weil Hermann wenig bis gar nichts Triviales vorstellt bzw. bespricht, sich auf die auch im Mainstream akzeptierten Größen der Science Fiction stützt. Ein paar wenige zeitgenössische oder fast zeitgenössische Autor:innen werden schon erwähnt: Aldiss, Haldemann, Vernor, Chambers, Hannig etc. Aber das Phänomen eines Heftchen-Romans, der seit Jahrzehnten in wöchentlichen neuen Fortsetzungen erscheint (ich meine natürlich Perry Rhodan) wird dem Publikum ganz unterschlagen, nur die US-amerikanischen Heftchen des 20. Jahrhunderts finden kurze Erwähnung in der Einführung. Eine Soziologie oder Politologie der Science Fiction müsste aber meiner Meinung nach gerade hier, im so genannt Trivialen, einhaken. Dass dieses Buch das nicht tut, ist für mich ein weiterer Beweis eines gymnasialen Zielpublikums. Das ist nicht an sich ein Übel, müsste aber besser ausgewiesen werden, finde ich.
So kann ich das Buch nur bedingt empfehlen – mit Ausnahme eines schulischen Gebrauchs, natürlich.
Isabella Hermann: Science-Fiction zur Einführung. Hamburg: Junius, 2023.