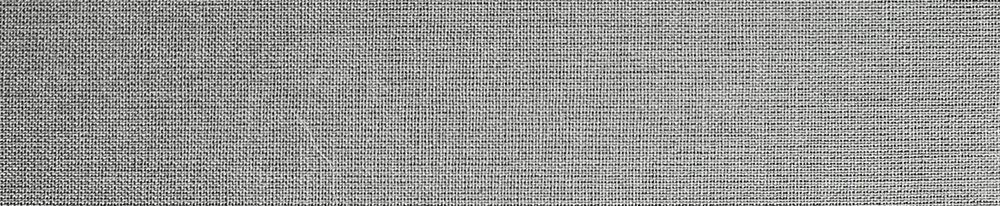Es mag daran liegen, dass der vorliegende Text das erste von Herder war, das ich je (damals im Studium nämlich) zu lesen bekommen hatte. Er gefiel mir schon damals und bis heute heute halte ich ihn für etwas vom Besten und Richtungsweisendsten, das Herder je geschrieben hat – ein Text, der immer noch wichtig ist für die Philosophie, die Philosophiegeschichte. Damals an der Uni war gerade ‚Sprachphilosophie‘ in aller Munde und so wurde auch dieser Text hier in die Genealogie sprachphilosophischen Denkens eingereiht. Das ist nicht falsch, aber heute würde ich das Gewicht auf einen anderen Aspekt legen.
Die Abhandlung erschien 1772 im Druck; Herder hatte sie allerdings schon 1769 bei der Berliner Akademie der Wissenschaften als Antwort auf eine Preisfrage eingereicht. (Sie erhielt denn auch den ersten Preis.) Die Gedanken hinter der Abhandlung sind aber noch älter. Sie stammen aus Diskussionen, die Herder und Hamann noch in Königsberg führten. Allein die Tatsache, dass sich Herder nicht nur häufig auf Condillac bezieht (und immer mit genauer Stellenangabe) sondern fast ebenso häufig auf Shaftesbury, zeigt auf diesen Hintergrund. Denn, anders als Hamann, der sich in London aufgehalten hatte, des Englischen einigermaßen mächtig war und so auch einen Text des englischen Philosophen übersetzt hatte, verstand Herder wohl kein Englisch. Seine Verweise auf Shaftesbury sind denn auch bezeichnenderweise ohne genaue Stellenangaben, was doch wohl darauf hinweist, dass er sie im mündlichen Gespräch mit Hamann erhalten hatte. Goethe hat später das Manuskript in Straßburg gelesen, aber wohl nichts zu Herders Gedanken beigetragen. Sprache wissenschaftlich oder philosophisch anzugehen, war sein Ding nicht.
Herder ist stützt sich zwar auf den Sensualismus ab, ist aber selber kein purer Sensualist. Und auch wenn er die Abhandlung beginnen lässt mit Schon als Tier hat der Mensch Sprache, vertritt er dennoch keine evolutionäre Ansicht über den Menschen. (Was an und für sich nicht unmöglich gewesen wäre; die Entdeckung der biologischen Evolution lag schon zu Herders Zeit in der wissenschaftlichen Luft – selbst in der eigenen Familie war Charles Darwin nicht der erste, der diesbezügliche Gedanken wälzte.) Sondern Herder unterscheidet hier Laute, die der Mensch von sich gibt als Tier, die also rein physiologische Befindlichkeiten ausdrücken wie Ausrufe des Schmerzes oder der Freude, von einer eigentlichen Sprache. Allerdings ist der Übergang fließend. In primitiven Sprachen – Herder übernimmt die zeitgenössische Anschauung, dass es grammatikalisch höher entwickelte Sprachen gäbe, zum Beispiel das später so genannte ‚Indogermanisch‘ und weniger entwickelte (darunter praktisch alle Sprachen nicht-weißer Völker, aber auch Jüdisch oder Arabisch) – in den primitiven Sprachen also existieren nach Herder sehr viel mehr Laute, die dem Ausdruck physiologischer Befindlichkeiten dienen.
Herders ganzer Aufsatz ist explizit gegen die vom (heute als Sprachphilosophen ansonsten unbekannten) Theologen Johann Peter Süßmilch in einem Text von 1756 (Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung nicht vom Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe) aufgestellte Behauptung gerichtet, dass es der liebe Gott gewesen sei, der dem Menschen die Sprachfähigkeit geschenkt habe. Der Theologe Herder beruft sich dabei natürlich auch auf die Bibel, genauer das Buch Genesis, wo er feststellt, dass Gott zwar die Tiere zu Adam bringt, auf dass er ihnen einen Namen gebe, aber ein Verleihen der Sprache als solche dabei nirgends erwähnt wird.
Wie aber kommt der Mensch zur Sprache? Bei den sensualistischen Wurzeln der Abhandlung wird es nicht verwundern, wenn es die Sinne sind, die dem Menschen erste Eindrücke der Außenwelt geben. Um diese Eindrücke aber im Gedächtnis aufbewahren zu können, braucht der Mensch Sprache. Den Vorgang imaginiert sich Herder so, dass es interessanterweise es weder Tast- noch Gesichtssinn sind, die die Sprache ‚triggern‘. Herders Mensch hört. Er betastet zum Beispiel ein Schaf, betrachtet es – aber seine Empfindungen blieben ungenau. Da hört er das Schaf blöken. Wichtig ist nun, dass dieses Geräusch den Menschen nicht zur Nachahmung triggert– Herder wendet sich vehement gegen die auch von Leibniz vorgebrachte Hypothese, dass die menschliche Sprache aus der Musik entstanden sei, und diese wiederum aus der Nachahmung der Vögel. Herders Mensch kennt auch keine vorfabrizierten Ideen im platonischen Sinn. Aber das Blöken des Schafs ruft in ihm etwas auf, das ihn denken lässt: „Ha! du bist das Blökende!“ Mit diesem Blökenden wird er einen eigenen Laut verbinden. Diese Art von Verstand oder Vernunft, dieser Drang danach, Gehörtes mit Worten zu klassifizieren und einzuordnen wiederum ist für Herder offenbar eine nicht weiter erklärte und erklärbare anthropologische Konstante. Diese Fähigkeit ist präsent vor jeder anderen. Ihren Ursprung lässt Herder offen. Er scheint aber einer Entwicklung zu unterliegen.
Denn sie isst in der Entwicklung des einzelnen Menschen nicht von klein auf im ganzen Umfang vorhanden. Im zweiten Teil der Abhandlung wird Herder tiefer auf die anthropologischen Konstanten im menschlichen Wesen eingehen. Ausgehend von der langen Entwicklungszeit des Säuglings und des Kindes ist es für Herder eindeutig, dass der Mensch von Anfang an auf die Hilfe anderer angewiesen ist (woraus dann Arnold Gehlen seinen Begriff des Menschen als eines Mängelwesens entwickeln wird), – andere, von denen er dann eine Familiendenkart und -sprache übernimmt. Nicht nur in die Familie ist der Mensch gestellt – diese steht wieder in größeren Gemeinschaften, die dann notwendig auch von einander verschiedene Sprachen ausbilden. Zusätzlich wirken sich jeweiliges Klima und die Art, sich zu ernähren, auf die Ausbildung einer Sprache aus. In einem längeren semantischen Exkurs geht hier Herder darauf ein, dass und warum die Eskimos viele Wörter für ‚Schnee‘ haben oder die Wüstenbewohner viele für ‚Sand‘. Vermittelt durch von Herder angeregte Überlegungen Wilhelm von Humboldts zur Sprache sind diese Gedanken dann zu den beiden US-Amerikanern Sapir und Whorf gelangt und haben die Linguistik des 20. Jahrhunderts stark beeinflusst. Allerdings betrachtet Herder diese Wörter für (zum Beispiel) ‚Schnee‘ eher als Synonyme denn als Bezeichnung von Verschiedenheiten in der realen Welt. So kommt er zum Schluss, dass ‚primitive‘ Sprachen mehr Synonyme kennen als die höher entwickelten.
Ich habe die Abhandlung über den Ursprung der Sprache als sprachphilosophische Schrift kennen gelernt. Heute würde ich ihre (nach wie vor vorhandene) philosophiegeschichtliche Wichtigkeit im philosophisch-anthropologischen Bereich sehen. Eine Lektüre lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall immer noch.