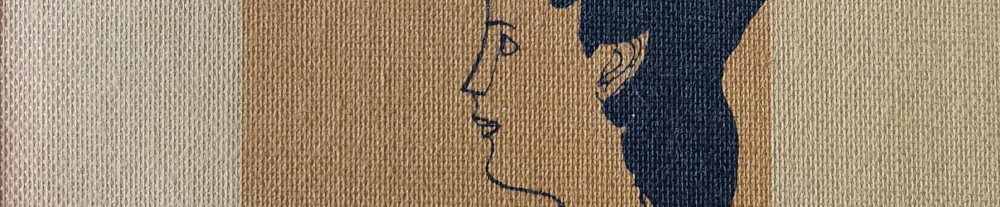„Lotte ist da! Lotte ist in der Stadt! Lotte in Weimar!“ – Ungefähr so müssen wir uns die Reaktion der Bevölkerung von Weimar vorstellen, jedenfalls wenn es nach Thomas Mann geht. Einen Menschenauflauf vor dem Gasthof Zum Elephanten, in dem die verwitwete Hofrätin Charlotte Kestner, geb. Buff, abgestiegen ist, inklusive. Doch Thomas Mann beabsichtigte ja keineswegs, einen wahrheitsgetreuen Bericht über Lottes Aufenthalt in Weimar zu verfassen. Denn – das nehme ich gleich vorweg – den Besuch von Charlotte Kestner im Jahr 1816 gibt es tatsächlich. Diesen Besuch und die damalige allgemeine Lage der Weimarer Nation nimmt Thomas Mann denn auch zum Grundgerüst seines Romans. So stimmt vieles mit der Realität überein, einiges stimmt fast, einiges gar nicht und von vielem wissen wir es nicht. Denn Mann bezieht die Lage der Weimarer Nation und die Goethes darin auch auf die Lage der deutschen Nation und sich selber darin. Aber wir finden so manches literarische Schmankerl darin versteckt, dass dieser Bezug oft in den Hintergrund tritt.
Zunächst (um dieses Thema abzuschließen) ist die reale Hofrätin Kestner keineswegs in einem Gasthof abgestiegen (auch wenn es den Elephanten gab und er der vornehmste im Ort war), sondern bei ihrer jüngsten Schwester Amalie, die mit dem Weimarer Geheimen Kammerrat Ridel verheiratet war und deren Besuch der primäre Anlass der Reise war. (Thomas Mann suggeriert, dass der Besuch nur vorgeschoben war und die Hofrätin von Anfang an vor allem jenen Mann besuchen wollte, der ihr vor 44 Jahren so penetrant und doch so liebenswert den Hof machte, obwohl er wusste, dass sie bereits verlobt war und den man deshalb auch des öfteren in die Schranken weisen musste, bis er eines Tages verschwunden war – nur um Lotte kurze Zeit später in einem Roman aufs Übelste bloß zu stellen – in einem Roman, der dazu noch in ganz Deutschland Furore machte. Über die Motive der Reise der echten Hofrätin wissen wir nichts.) Das Essen, zu dem sie Goethe eingeladen hat, fand tatsächlich statt; aber der echte Goethe war sensibel genug, sie en famille – also nur die Kestners und die Ridels – einzuladen und nicht in großer Gesellschaft von 16 Personen, von denen Charlotte die meisten gar nicht kannte. Auch dass Goethe ihr seine eigene Kutsche zur Verfügung stellte, falls sie das Weimarer Theater besuchen wollte, ist durch ein Billett aus seiner Hand bezeugt. Last but not least war die Hofrätin nicht von ihrer Tochter Charlotte begleitet, sondern von einer jüngeren namens Clara. (Aber Thomas Mann brauchte die Namensgleichheit, um den seltsamen Empfang schildern zu können, den sein Goethe der ehemaligen Geliebten bereitet, indem er ihr gleich zusammen mit ihrer Tochter die Hand gibt und die beiden Charlotten gleich in der Mehrzahl anreden kann, was die Seltsamkeit etwas verbirgt, dass er seinerseits von sich im Pluralis Majestatis spricht.)
Im Übrigen aber verfolgt Thomas Mann in seinem Roman eigene Ziele. Viele eigene Ziele sogar. So viele, dass ich hier nicht alle erwähnen weder kann noch möchte. Fangen wir mit der Sprache an. Mann verwendet fast durchgehend ein Pastiche des Goethe’schen Prosa-Kurialstils, den der sich angewöhnt hatte. Ob Mager (das Faktotum des Elephanten), Riemer (das Faktotum Goethes), August von Goethe (noch ein Faktotum des alten Goethe bei Mann, der ihn als völlig abhängig von seinem Vater beschreibt) oder Adele Schopenhauer (Tochter der Johanna und somit Schwester des Arthur), die doch einem Zirkel junger Frauen angehört, die bei aller Anerkennung der Größe Goethes doch die jungen Romantiker anbeten, Caspar David Friedrich, Ludwig Uhland und E. T. A. Hoffmann – Frauen, die preußisch gesinnt sind und nicht napoleonisch wie Goethe. Am Schönsten aber diesbezüglich ist Kapitel 7 des Romans. Schon in der Überschrift ist es speziell ausgezeichnet: Während die alle anderen Kapitel ganz simpel Erstes Kapitel, Zweites Kapitel etc. lautet, nennt sich N° 7 etwas pompös Das siebente Kapitel. Tatsächlich fällt Kapitel 7 aus dem Rahmen. Hatten wir bisher Lottes Ankunft in Weimar und verschiedene Gespräche mit Einheimischen, die sie aufsuchten (inkl. einem Abriss der seltsamen Werbung des August von Goethe um Ottilie von Pogwisch – die zu hintertreiben Adele Schopenhauer von Lotte wünscht), so dreht Mann im 7. Kapitel das Rad der Zeit noch einmal auf den Morgen zurück. Bisher hat man nur über Goethe geredet, nun stoßen wir auf ihn selber, nämlich bei seinem Erwachen am Morgen früh, was denn auch den pompösen Titel erklärt. Ohne Vorwarnung finden wir uns mitten in den Gedanken des erwachenden Goethe. Und nun verdoppelt Thomas Mann seine Parodien. Was wir hier im 7. Kapitel haben, ist einerseits ein Pastiche auf die literarische Technik des Bewusstseinsstroms. Pastiche, weil: Dieser Goethe denkt, wie er schreibt. Es ist aber auch ein Pastiche auf Goethes Sprache direkt. Thomas Mann übernimmt zum Teil wörtlich, zum Teil wandelt er ab, was Goethe an Gescheitem und weniger Gescheitem je zur irgendwas geschrieben hat. Somit dient Goethe dem Autor Mann auch als Maske, hinter der hervor er die Deutschen so richtig kritisieren kann (Lotte in Weimar erschien 1939!). Andererseits ist sein Goethe aber auch einer, der sehr den restaurativen Tendenzen jener Jahre unmittelbar nach Napoléon anhängt – den französischen Kaiser allerdings davon ausnehmend. Mann fährt mit diesem Thema fort, wenn er im folgenden Kapitel die Tischreden Goethes (ja, die Assoziation mit Luther ist von Mann gewollt!) referiert, wo er allenfalls, wenn es um Gesteine geht oder die Qualität des Eger’schen Mineralwassers neutral bleibt. Diese Themen interessieren die Hofrätin allerdings nicht. Wo Manns Goethe aber auf Zeitgenössisches zu sprechen kommt, entpuppt er sich als antisemitisch und xenophob. (Was die Hofrätin beängstigt und gleichzeitig Manns kompliziertes Verhältnis zu Goethe charakterisiert.)
Der Roman handelt aber auch vom Altern, von der Legitimität, lebende Menschen als Vorbilder für literarische zu nehmen, von der Liebe und vom Überwinden einer Liebe. Und wenn dann Thomas Mann seinen Goethe darüber sinnieren lässt, dass auch ihm die griechische Liebe eines Winckelmann nicht fremd sei, er sich dabei wohlgefällig eines hübschen jungen Kellners erinnert, der ihn am Rhein bei einem Ausflug mit Boisserée und den Willemers bedient hat, so macht Mann sich vor allem wohl über sich selber lustig – der echte Goethe war zu jener Zeit völlig im West-östlichen Divan versunken und den Beiträgen, die ihm die junge Marianne Willemer lieferte.
Was darf Kunst? Was kann Kunst? Diese Frage war 1939 einmal mehr sehr aktuell. Und wenn Charlotte Kestner zum Schluss tatsächlich eine Aufführung des Weimarer Hoftheaters besucht, so erhält sie darauf Antworten, die ihr nicht gefallen. Es wird (das heute vergessene) geschichtliche Trauerspiel „Rosamunde“ von Theodor Körner aufgeführt. Körner, der Sohn von Schillers Jugendfreund (Schiller, mit dem Manns Goethe übrigens in seinem Gedanken immer wieder spricht), starb bekanntlich in den Freiheitskriegen. Da der Autor mit dem Nimbus des vaterländischen Helden bekränzt ist, kann sein weniger als mediokres Stück das Weimarer Publikum begeistern. Das spricht gegen das Publikum ebenso wie gegen die Kunst – und gegen die Deutschen (was Mann hier nicht mehr explizit sagt).
Es gibt noch viel mehr. Auf praktisch jeder Seite stolpert man beim Lesen über Interessantes und Erwähnenswertes. Aber ich will hier abbrechen. Am besten den Roman selber lesen!
PS. An Lotte in Weimar erinnert hat mich übrigens eine Rezension der Biografie des August von Goethe von Stephan Oswald in der Zeit, über die ich stolperte, als ich nach den Lebensdaten von Oswald gesucht habe. Der Rezensent, Golo Maurer, widmet etwa die Hälfte seines Textes früheren Biografien des unglücklichen Goethe-Sprosses, davon auch einen Abschnitt der Darstellung in diesem Roman hier. Je nun. Wenn man schon den Vornamen Golo trägt …