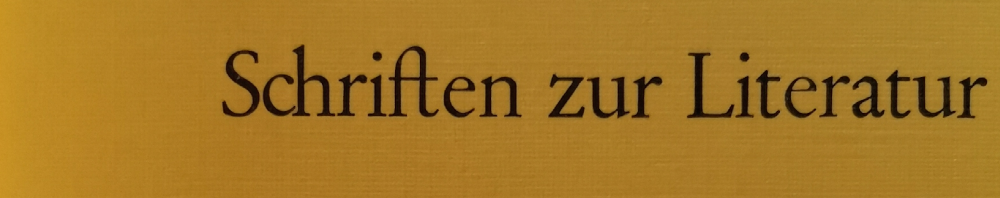Bodmer / Breitinger sind so etwas wie die siamesischen Zwillinge der Geschichte der deutschen Literatur. Fast immer werden sie zusammen erwähnt (und wenn einer alleine, ist es vorwiegend Bodmer). Sie haben tatsächlich auch sehr viel – vor allem literatur- und kunsttheoretische – Texte zusammen geschrieben. Beide waren von Haus aus Theologen, widmeten sich aber bald der Philologie. Und bei beiden gilt, dass ihre eigenen literarischen Werke schon von den Zeitgenossen eher verrissen als genossen wurden. In ihren theoretischen Schriften aber wurden sie wegweisend für die neue deutsche Literatur (wie zu meiner Zeit sogar das diesbezügliche Studienfach an der Universität hieß). Dennoch waren sie im ganzen deutschen Sprachraum berühmt (oder berüchtigt – je nach Einstellung), und sie machten aus der kleinen Stadt Zürich für kurze Zeit einen Hotspot der deutschen Literatur.
Die theoretischen Schriften der Zürcher wurden zunächst in Übereinstimmung, dann mehr und mehr in Abgrenzung und Widerspruch zu denen Gottscheds verfasst. Der Literaturstreit zwischen Gottsched und Bodmer / Breitinger wird oft mit der französischen ‚Querelle des anciens et des modernes‘ verglichen, die gegen Ende des 17. Jahrhunderts an der Académie française geführt wurde. Es gibt allerdings signifikante Unterschiede, die nur teilweise darin begründet liegen, dass der deutsche Literaturstreit runde 50 Jahre später ausgetragen wurde.
Die französischen ‚anciens‘ behaupteten, dass nach wie vor die antiken Schriftsteller das Maß aller Dinge vorstellen würden und müssten. Das ging so weit, dass sie – in einer Überinterpretation – aus der Poetik des Aristoteles ableiteten, ein ‚klassisches‘ (also: gutes) Drama müsste die drei Einheiten von Zeit, Ort und Handlung einhalten. Die ‚modernes‘ griffen zwar nicht unbedingt die drei Einheiten an, vertraten aber im Übrigen die Meinung, die französische Kultur im Allgemeinen, die französische Literatur im Besonderen, hätten nun eine Höhe erreicht, die der der Antike gleichwertig wäre, weshalb sich das ständige Schielen auf eben diese erübrigen würde. Seltsam genug, dass zwar im weiteren Verlauf der Literaturgeschichte die ‚modernes‘ Recht behielten, wenn man aber schaut, welche Autoren aus jener Zeit bis heute bekannt geblieben sind, wird man feststellen, dass die meisten davon ursprünglich der Fraktion der ‚anciens‘ angehörten …
Die deutschen ‚anciens‘ (sprich: Gottsched und seine Anhänger) ihrerseits orientierten sich primär nicht an der Antike sondern an den Folgerungen, die die französischen ‚anciens‘ aus deren Analyse gewonnen hatten. Ihre geistigen Führer waren nicht Aristoteles oder Sophokles sondern Boileau und Fénelon, deren Regeln sie einer starren Kodifizierung zuführten. Die ‚modernes‘ (also Bodmer / Breitinger & Co.) wiesen einen breiteren Horizont auf. Dieser breite Horizont drückte sich von Anfang an in ihren Schriften aus, und ging anfangs sogar über die Literatur hinaus. Die Discourse der Mahlern von Bodmer / Breitinger waren ursprünglich nicht nur literaturtheoretisch, sondern ganz allgemein kunsttheoretisch gemeint, wie ja schon der Titel anzeigt. Im engeren Bereich der Literatur schätzten und lobten Bodmer / Breitinger die Engländer (Milton, Addison, Pope oder Shakespeare) ebenso wie sie auf nicht-klassische Franzosen zurückgriffen (Montaigne, Rabelais – dessen deutsche „Übersetzung“ durch Fischart sie lobend erwähnen), oder Dantes Divina Commedia kannten und analysierten. Und obwohl Gottsched wie Bodmer Schüler bzw. Schülersschüler von Christian Wolff waren, weist Bodmer breiter abgestützte Kenntnisse der antiken Philosophie auf. Der antiken Literatur logischerweise auch. Diese breiten Kenntnisse ließen die Zürcher denn auch rasch Gottscheds starres Regelwerk zurückweisen und statt dessen für die Freiheit der dichterischen Phantasie plädieren. Auch im deutschen Sprachraum waren es so die ‚modernes‘, die literaturgeschichtlich gewinnen sollten. Ihr Plädoyer für die Freiheit der Imagination verhallte bei den schon bald auftauchenden Genies der Sturm und Drang-Bewegung nicht ungehört. Noch vorher war, zumindest eine Zeitlang, Klopstock der führende Autor der neuen, modernen Generation. Wieland wäre zwar zunächst fast vom engherzigen Religionswesen der beiden Zürcher (vor allem Bodmers) zu Grunde gerichtet worden, konnte sich aber gerade noch rechtzeitig daraus befreien und wurde so zum Erfinder der modernen deutschen Literatur, wie ihn Reemtsma im Untertitel seiner kürzlich erschienen Biografie nannte. Gottscheds Richtung aber versickerte schlussendlich im trockenen Boden von dessen Regelwerk, zumal er selber auch nicht der begnadete Dramatiker war, für den er sich hielt.
Und noch in anderen Punkten wurden Bodmer / Breitinger wegweisend. Nicht nur hat Bodmer, wie sein Konkurrent Gottsched, die Gedichte des Martin Opitz (den beide als Literaturtheoretiker für ihr Lager in Anspruch nahmen) herausgegeben; er hat auch – anders eben als Gottsched – nicht selber daran herumgedoktert und vermeintliche Fehler korrigiert, sondern in einer Frühform der kritischen Ausgabe von heute einfach, wo vorhanden, die verschiedenen Varianten des Opitz’schen Textes nebeneinander gestellt. Nicht immer allerdings war Bodmer so sorgfältig zu Gange. Den beiden Zürchern gebührt durchaus die Ehre, als erste auf die mittelhochdeutsche Literatur aufmerksam gemacht zu haben (die sie die staufische Literatur nannten, weil im Mittelalter vor allem das Kaiserhaus der Staufer die verschiedenen Sänger protegierte). Damit bereiteten sie der Romantik und deren philologischen Anstrengungen den Boden vor.
Seltsam genug mutet es allerdings aus heutiger Sicht an, wenn Bodmer, der gerade noch Gottsched heftig dafür getadelt hatte, in die Verse des Martin Opitz eingegriffen zu haben, sich seinerseits erlaubte, das später als Nibelungenlied bekannt gewordene mittelalterliche Versepos in einer auf Kriemhilds Rache zurück gestutzten Version herauszugeben und diesen Verschnitt in bester Gottsched’scher oder Boileau’scher Manier damit zu rechtfertigen, dass ja auch Homer nicht die ganze Vorgeschichte des Trojanischen Kriegs erzählt habe sondern nur den Zorn des Achilleus. Nun, die bald folgenden Romantiker sollten das korrigieren.
Die von mir gelesene Textauswahl erschien seinerzeit, herausgegeben von Volker Meid, bei Reclam als N° 9953 in der Universalbibliothek. Mein Exemplar trägt ein © von 1980. Das Büchlein ist inzwischen vergriffen und nicht einmal als Print on Demand mehr erhältlich …