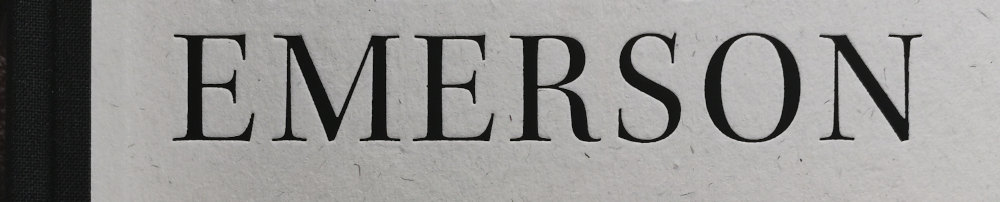Tagebücher sind ungefähr so individuell wie die Personen, die welche schreiben. Das gilt natürlich auch für jene, die den Weg ans Licht der Öffentlichkeit gefunden haben. Da sind jene, die in großer Regelmäßigkeit, oft wirklich täglich, geführt werden, die aber im Grunde genommen nur mehr oder minder repetitive Aufzählungen dessen sind, was der oder dem Schreibenden an diesem Tag zugestoßen ist. Ein typisches Beispiel sind die 72 Notizbücher, die der Revd. James Woodforde zwischen 1759 und 1803 gefüllt hat. Unser heutiges Interesse an ihnen existiert vor allem deswegen, weil sie in ihrer exzessiven Form das tägliche Leben jener Epoche auf dem Land so präzise schildern, wie es kein Durchreisender je vermocht hätte. So ganz nebenbei enthüllt auch dieser Kauz trotz allem Kleben an Äußerlichkeiten nicht wenig von sich selbst.
Andere Tagebücher konzentrieren sich darauf, die wichtigen Gespräche aufzuführen, die der oder dem Schreibenden an diesem Tag zu Ohren gekommen sind. Die Berichte über Johnson und Goethe von Boswell und Eckermann respektive sind aus solchen Notizen entstanden, die berüchtigten Tagebücher der Brüder Goncourt ebenfalls. (Wir sehen so nebenbei, dass einige Tagebücher auch bereits mit einer Veröffentlichung im Hinterkopf geschrieben oder zumindest redigiert wurden.)
Ralph Waldo Emersons Tagebücher gehören zu einer dritten Sorte. Nicht täglich nachgeführt und, vor allem in den späteren Jahren, oft auch ohne Datum notiert, finden wir darin nicht nur das alltägliche Allerlei, das ihn begleitet hat: Er verwendet seine Notizbücher auch als Repertorium für seine Gedanken oder für Formulierungen, die ihm gefallen. Ebenfalls finden wir Zitate – oft flüchtig und nicht korrekt niedergeschrieben, weil er sie offenbar aus dem Kopf wiedergibt, oft Zusammenfassungen jener Gedanken, die er zu zitieren scheint, oft auch zitiert nach Werken der Sekundärliteratur, die ihrerseits schon die Primärliteratur zusammengekürzt haben. Es ist ein wüstes Durcheinander, wie halt auch das Leben ein wüstes Durcheinander ist.
Aus den rund 250 Notizbüchern, die Emerson hinterlassen hat, sind von 1960 bis 1982 The Journals and Miscellaneous Notebooks of Ralph Waldo Emerson gebildet worden – 16 Bücher mit insgesamt 8500 Seiten. Aus diesen 8500 Seiten hat der Übersetzer und Herausgeber der vorliegenden deutschen Auswahlausgabe, Jürgen Brôcan, seinerseits rund 900 herausdestilliert. Wir sehen in diesem Buch wie sich Emerson von einem der vielen provinziellen Prediger und Theologen einer der vielen in den jungen USA florierenden Kirchen entwickelt hin zu einem eigenständigen (wenn auch nicht sehr klaren!) Denker, der das Zentrum einer Gruppe von Intellektuellen wurde, die man heute allgemein als Transzendentalisten zusammenfasst. Den Anstoß zu seiner ‚Konversion‘ zum Transzendentalisten gab wohl einerseits der Tod seiner ersten Frau, deren Grab und Sarg er zwei oder drei Jahre später öffnen wird. Was er genau gesehen hat, geht aus den Tagebucheinträgen nicht hervor – jedenfalls scheint es seine bis dato doch recht konventionelle christlich-unitarische Frömmigkeit in ihren Grundfesten erschüttert zu haben. Andererseits war Emerson schon immer ein ‚Buchmensch‘, und so werden wir der Lektüre von Goethe und Schelling wohl ebenso viel Gewicht bei seiner philosophischen Entwicklung beimessen müssen. Obwohl sie in Concord, Emersons Wohnort, einen Club der Transzendentalisten bildeten, waren die Ansichten der einzelnen Mitglieder recht unterschiedlich. Wenn Emerson einmal in seinem Tagebuch notiert, dass es so viele Kirchen wie Gläubige gebe, jede Kirche also nur ein Mitglied habe, so gilt Ähnliches wohl auch für den Transzendentalismus. Emersons Version war eine recht ekstatische – er zog unter den deutschen und englischen Romantikern Goethe oder Novalis dem kritischen Geist der Aufklärer vor. (Nebenbei: Auch wenn Emerson einmal angibt, seine Lektüre lieber in der Muttersprache zu tätigen, so ist doch erstaunlich, wie viele deutsche Autoren er in der Originalsprache gelesen haben muss.) Bezeichnenderweise werden später in seinem Leben fernöstliche religiöse Texte hinzu kommen.
Natürlich finden wir in seinen Notizen auch welche zu Gesprächen, die er mit diesem oder jenem führte. David Henry Thoreau ist darunter der wohl hierzulande bekannteste. Jedenfalls in der von Brôcan getroffenen Auswahl ist es interessant zu sehen, wie der weltberühmt Aufenthalt Thoreaus am Walden Pont für Emerson (auf dessen Grund und Boden Thoreau ja kampierte!) nur ein beiläufig zu erwähnendes Ereignis ist. Die Gespräche (und die auftauchenden Differenzen in ihren Anschauungen) mit H. D. T., wie er ihn oft abkürzt, sind ihm wichtiger.
Ein weiterer wichtiger Punkt – der Punkt auch, an dem sich seine Ekstase regelmäßig zu entzünden pflegt – ist die Natur. Wenn Emerson nicht in seiner Bibliothek sitzt und liest (eine Bibliothek, die – vor allem deren Nachschlagewerke! – ihm mit zunehmendem Alter immer wichtiger wird), spaziert er stundenlang in der Gegend herum. Dabei betrachtet und bestimmt er viele Pflanzen der Umgebung, verfolgt und bestimmt er viele Singvögel der Gegend. Hier sehen wir Emerson wirklich an der Arbeit als einen der Väter des ‚Nature Writing‘.
Dabei dürfen wir ihn nicht als rabiaten Umweltschützer im heutigen Sinn sehen. Er sieht wohl (und konstatiert es in seinen Tagebüchern ein wenig traurig), dass sich gewisse Pflanzen vor der Zivilisation in den Westen zurück ziehen, aber es kommt ihm nicht in den Sinn etwas dagegen unternehmen zu wollen. Den Bau einer Eisenbahnlinie durch Concord befürwortet er ganz und gar, gibt das ihm doch die Möglichkeit, schneller und einfacher nicht nur nach Boston zu kommen, sondern von da weiter in die Welt. (Immerhin unternahm er neben vielen Vortragsreisen in den USA auch zwei Reisen nach Europa, wo er in England die führenden Romantiker der Zeit persönlich kennen lernte.) Ähnliches gilt für die Fotografie, die er als Mittel sah, die subjektiven Täuschungen der Maler in der Porträt-Malerei zu eliminieren und so zur Wahrheit der jeweils Fotografierten zu gelangen.
Emersons Einsatz für die Abschaffung der Sklaverei in den USA ist bekannt, und wird auch von ihm immer wieder erwähnt. Seine Reise zu Präsident Lincoln nach Washington D. C. nimmt dann allerdings nur einen kleinen Platz im Buch ein – ich vermute aber, dass das so ist auf Grund der Auslassungen, die der Herausgeber getätigt hat. Heute vielleicht weniger bekannt ist wohl, dass er der Vertreibung der Indigenen (der Indianer) keineswegs zustimmt. Vor allem in den frühen Texten äußert er sich das eine oder andere Mal sehr kritisch dazu, tat es auch in der Öffentlichkeit übrigens, denn er war keiner von denen, die im stillen Kämmerchen lauthals murren, vor der Tür aber keinen Muckser von sich geben. In Bezug auf die Frauen war er allerdings dann weniger fortschrittlich – er betrachtete sie als unstet und nicht in der Lage, ein selbständiges Leben zu führen. Diese Haltung mutet um so merkwürdiger an, als sich in seiner Umgebung jede Menge Frauen befanden, die heute als Vorkämpferinnen der Emanzipation gelten.
Nicht nur ‚Nature Writing‘ und Thoreau verdanken Emerson viel; er gehörte auch den ersten und bekanntesten Kritikern, die Walt Whitmans Leaves of Grass in den höchsten Tönen lobten. (Andere seiner Schützlinge, wie es halt so ist mit Literaturkritik, sind heute völlig vergessen.)
900 Seiten geballte Information – nicht nur zu Emerson selber, nicht nur zum Transzendentalismus, sondern vor allem zur Intelligentsia jener Epoche und jenes Ortes. Concord wurde durch Emerson zu einem Brennspiegel der US-amerikanischen (Geistes-)Entwicklung und wir finden in seinen Tagebüchern deshalb auch das Bild jener Zeit, in der die USA definitiv zur Form und (geistigen) Verfassung fanden, die sie bis heute haben. Den Transzendentalismus dürfen wir getrost vergessen – die Persönlichkeit des Ralph Waldo Emerson aber und die ganzen Umstände, in denen er lebte und wirkte, verdienen durchaus auch im 21. Jahrhundert noch unser Interesse.
Ralph Waldo Emerson: Tagebücher. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt, herausgegeben und kommentiert von Jürgen Brôcan. Berlin: Matthes & Seitz, 2022. [Ein mit etwas über 900 Seiten auch äußerlich imposantes und elegantes Buch, Halbleinen mit Lesebändchen. Inhaltlich wäre allenfalls zu bemängeln, dass man dem Anhang keinen Index der Personen, Orte und Werke beigefügt hat.]