Auch dieser Text gehört, wie die Weltgeschichtlichen Betrachtungen des gleichen Autors, zu jenen Schriften, die nach seinem Tod von seinem Neffen und Nachlassverwalter nach Jacob Oeri gefunden und – entgegen dem ausdrücklichen Auftrag des Toten – nicht vernichtet sondern postum publiziert wurden. Auch hier handelte es sich um die Vorlage zu Vorlesungen; allerdings hatte Jacob Burckhardt deren Veröffentlichung noch selber vorgesehen. Nur war er offensichtlich mit der Überarbeitung des Texts nicht mehr fertig geworden. Es handelt sich hier zwar nicht um ein eigentliches Fragment, aber dass am Text noch einige Arbeit zu leisten gewesen wäre, merkt man bei der Lektüre sofort.
So beginnt der Text mit rund 450 Seiten zu den Griechen und ihrem Mythus, Staat und Nation, Religion und Kultus, dem griechischen Orakelwesen und einer Gesamtbilanz des griechischen Lebens. Vor allem der zuletzt erwähnte, fünfte Abschnitt bringt eine brillante Zusammenfassung seiner Kritik an der Auffassung des Griechentums, wie sie zu seiner Zeit, zumindest im deutschen Sprachraum, vorherrschend war. Von einer irrigen Rezeption des Griechentums durch die deutsche Klassik verführt (Burckhardt nennt exemplarisch Schillers Gedicht Die Götter Griechenlands), sah man in der Zeit des Perikles, also in der Zeit zwischen den Perserkriegen und dem Peleponnesischen Krieg, eine Art Goldenes Zeitalter der Antike und natürlich vor allem Athens. Burckhardt hält dem sehr viele pessimistische Aussagen der Zeit entgegen, last but not least eine Tendenz der Antike, ein hohes Alter beim Menschen nicht als ehrwürdig zu betrachten, sondern als Last (für den Menschen wie für die Gesellschaft), eine Tendenz daher, sich umzubringen, bevor man die Last des Alters verspürte, was wiederum eine Tendenz hervor rief, das Leben im Allgemeinen als kein besonders hohes Gut einzustufen. Auf diesen 450 Seiten entwickelt Burckhardt ein nachgerade Schopenhauer’sches pessimistisches Pathos bei der Präsentation griechischen Seins und Lebens.
Leider widerruft er gewissermaßen den – zumindest schriftstellerisch großartig gelungenen – Passus über das Griechentum im Allgemeinen, wenn er im Folgenden die ersten Abschnitte zu vertiefen sucht, indem er sich zunächst über die bildende Kunst bei den Griechen auslässt, dann über die Poesie und Musik. Nicht nur wiederholt er vieles von dem, was er schon gesagt hat, oder weist darauf zurück. Auch kann er im sechsten und siebten Abschnitt fast nicht genug davon kriegen, zumindest die Kunst der Zeit vor und bis zu Perikles in höchsten, schwärmenden Tönen zu loben. (Allerdings habe ich hier, noch vor Nietzsche, die Schilderung gefunden, wie bei Zerfall der Künste die dionysische Musik und Kunst sich nachgerade gewaltsam Einlass verschafft hat in die apollinische Welt – sprich: Kultstätten.)
Es erscheint also ganz allgemein nach dem fünften Abschnitt ein eklatanter Kontrast zum vorher Gesagten. Der Ton ändert zwar wieder im achten Abschnitt Zur Philosophie, Wissenschaft und Redekunst, dafür kann er hier ganz allgemein nur wenig Substanzielles vorbringen. Er will ja zum Beispiel bewusst keine eigentliche Philosophiegeschichte dozieren, aber was die Philosophie zum griechischen Wesen ihrer Zeit beigetragen hat, kann er dann ohne Philosophiegeschichte schon gar nicht nachweisen. Dass die antiken Griechen keine Wissenschaftler gewesen sein, weil die Babylonier, Ägypter und Perser sie hierin übertroffen hätten, steht für ihn fest. Eine Feststellung, die er quasi a priori trifft – treffen muss, weil es für ihn fest steht, dass der antike Grieche im Grunde genommen ein Zoon politikon gewesen ist. Oder, wie er es nennt, ein agonaler Mensch, ein Mensch, der sich vorwiegend im Wettkampf ausdrückt. Und Burckhardt denkt dabei nicht nur an die Olympischen Spiele der Antike, sondern auch daran, dass ja sogar die Tragödiendichter ihre Stücke um die Wette dichteten und vor einer Jury aufführen ließen.
Insofern ist für ihn dann die Rhetorik, die für das abundante Gerichtswesen und für die Auftritte in der Volksversammlung absolute Notwendigkeit war, der eigentliche Ausdruck griechischen Wesens. Die Volksversammlung wiederum war in Burckhardts Augen das Instrument der alten griechischen Demokratie. Die wiederum war in seinen Augen eine Ansammlung des Pöbels (auch wenn er das Wort nicht verwendet), der von Demagogen geleitet werden konnte, wie es diesen gerade passte. Wer nicht spurte oder in den Augen eines Denunzianten Fehler begangen hatte, wurde von diesem Pöbel gnadenlos vor Gericht gezogen und in den meisten Fällen auch verurteilt. Der antike Grieche κατ’ ἐξοχήν, der Athener, hat das Spiel eines stetigen Wechsels von Demokratie zu Oligarchie und zurück so häufig gespielt, dass zum Schluss, in der hellenistischen Zeit, keine Kraft mehr vorhanden war, den eindringenden Makedoniern noch wirklich Widerstand leisten zu können. In seiner Verachtung der Demokratie als einer Herrschaft des Pöbels (wie gesagt, er verwendet dieses Wort – wohl bewusst – nicht), seiner Bevorzugung der Oligarchie als der Herrschaft der überlegenen Rasse, drücken sich Burckhardts dunkelste Seiten aus, auch wenn er der Oligarchie nicht nur Gutes nachredet.
Überhaupt operiert er in keiner seiner vier großen Schriften so häufig mit dem Begriff der Rasse oder des Stammes wie hier. Stamm wiederum ist bei ihm immer der alte Begriff aus der Bibel, wo die drei Söhne Noahs die Urväter der Stämme waren, die hernach ums Mittelmeer herum um die Vorherrschaft rangen. Die Karthager sieht er dabei als Leute vom Stamme Cham an. Selbst die in hellenistischer Zeit sich assimilierenden Juden, die nach seiner eigenen Aussage auch als Soldaten oder Bauern in den Diadochen-Staaten tätig waren, sieht er doch primär als Kaufleute, die nur deshalb nicht auch nach Karthago vorgedrungen sind, weil die Karthager (die er prinzipiell als beutegierige Kauffahrer schildert) im Handel noch raffinierter waren als die Juden. Und wenn er an den Eroberungen eines Philipp von Makedonier und seines Sohnes Alexander (den man später den ‚Großen‘ nennen sollte) etwas Gutes sieht, ist es der Umstand, dass sie ein – und sei es auch noch so degeneriertes – griechisches Wesen weit über Persien, Babylon und Ägypten streuten. Zusammen mit dem Philhellenismus der alten Römer habe das, so Burckhardt, den Boden vorbereitet für das Vordringen des Christentums nach Europa. Das ist offenbar für ihn etwas sehr positiv Einzuschätzendes, auch wenn er diese seine Einschätzung nicht begründet. (Und sie historisch wohl auch nicht begründbar ist.)
Und wenn ich bisher vom ‚Griechen‘ schlechthin gesprochen habe, so ist das durchaus im Sinne Burckhardts und entspricht auch der damaligen Realität. Griechenland: das waren in der Antike die freien griechischen Männer. Es gab im antiken Griechenland zwar nicht nur den in der Agora stimmberechtigten Bürger, es gab auch den Metöken (den freien, aber nicht stimmberechtigten Griechen aus anderen Städten) und es gab die Sklaven, die praktisch alle Arbeit verrichten mussten. Letzteren widmet Burckhardt sogar ein längeres Kapitel. Es gab aber auch – und auch diesen widmet der Autor ein längeres Kapitel – die Frauen. Ohne über ein anderes Recht zu verfügen, als für Nachkommen zu sorgen, waren sie im Staat nur wenig besser gestellt als die Sklaven. Dass die Nachkommen männlich zu sein hatten, versteht sich. (Mädchen und auch körperlich Versehrte wurden gern gleich nach der Geburt getötet – auch das ein Aspekt der goldenen griechischen, nach Schönheit gierenden Antike, der bis heute gern verdrängt wird, und den Burckhardt in Erinnerung ruft.)
Übers Ganze gesehen, gilt für die Griechische Kulturgeschichte, was ich schon zu den Weltgeschichtlichen Betrachtungen gesagt habe. Sie ist
[…] ein merkwürdiges, hybrides Gebilde aus modernen An- bzw. Einsichten und reaktionärem Stolz auf seine Zeit, seine Rasse, sein Bildungsbürgertum. Ich kann es nicht empfehlen, aber auch nicht ganz verwerfen.
Nur, dass hier noch der nostalgische Stolz eines aus der einst herrschenden Schicht der Patrizier Stammenden auf die alte Verfassung hinzu kommt, der ihn die moderne Demokratie ebenso verachten lässt wie die Ausprägung, die sie einst im alten Athen hatte.

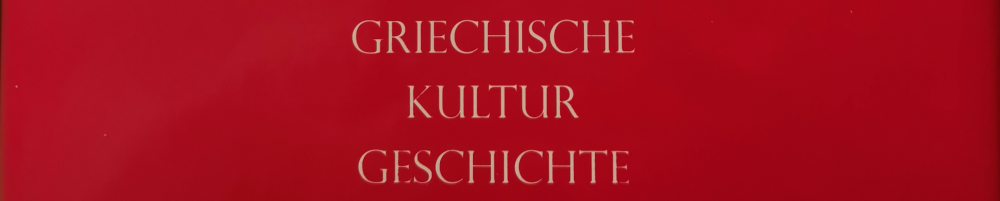
2 Replies to “Jacob Burckhardt: Griechische Kulturgeschichte”